
Psychokardiologische Aspekte im Fokus Wie Stress das Herz krank macht
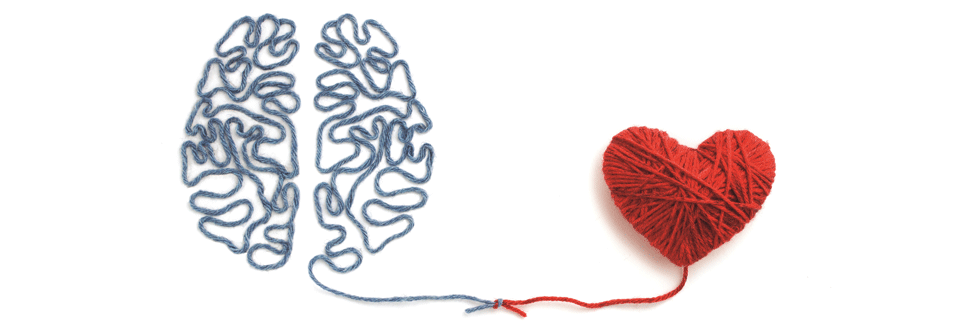 Stresssituationen belasten nicht nur die Psyche, sondern auch das Herz-Kreislauf-System.
© TanyaJoy - stock.adobe.com
Stresssituationen belasten nicht nur die Psyche, sondern auch das Herz-Kreislauf-System.
© TanyaJoy - stock.adobe.com
Neben genetischen und klassischen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, erhöhten Blutfettwerten oder Diabetes mellitus beeinflussen auch Umwelt- und Verhaltensaspekte maßgeblich die Entstehung und den Verlauf von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Untersuchungen haben ergeben, dass 40–60 % der chronischen kardiovaskulären Krankheitslast auf psychosoziale und verhaltensbezogene Faktoren sowie auf die physische Umgebung zurückzuführen sind. Im Versorgungsalltag würden diese Aspekte jedoch meist weniger berücksichtigt, schreibt Dr. Boris Leithäuser, niedergelassener Kardiologe in Hamburg. Das könne die Effekte kardiovaskulärer Therapieregimes schwächen.
Mehr Defi-Schocks bei akuten Stressereignissen
In den letzten Jahrzehnten sorgten Stresssituationen, die einen großen Teil der Bevölkerung betrafen, für eine Häufung ICD-behandelter ventrikulärer Arrhythmien. Beispielsweise verdoppelten sich in einer Analyse die durch ICD dokumentierten ventrikulären Tachykardien (VT) innerhalb von 30 Tagen nach dem 11. September 2001 – und zwar nicht nur in New York, sondern auch in Florida. Ähnliches geschah nach dem schweren Erdbeben in Japan 2011 und während der Fußball-WM 2014.
Der Experte beschreibt, wie akuter, wiederholter und chronischer Stress in unterschiedlichen Lebenssituationen das Herz-Kreislauf-System beeinträchtigen kann. Dabei variiert die mit Stress assoziierte Psychobiologie in Abhängigkeit von der Expositionsdauer. Vermittelt werden die Effekte über autonome, endokrine und immunologische Regelkreise.
Schon Fußballgucken kann zur Hyperkoagulabilität führen
Auf akute bzw. kurzfristige Stresssituationen (z. B. heftiger destruktiver Ärger, aber auch ein emotional aufreibendes Fußballspiel) reagiert der Körper mit einer Aktivierung des autonomen Nervensystems und der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse. Es kommt zu einer Hyperkoagulabilität und zur Freisetzung neurohormoneller und inflammatorischer Mediatoren.
Die Beziehung zwischen kardiovaskulärer Gesundheit und dem Umgang mit Stress wird besonders am Tako-Tsubo-Syndrom (TTS) deutlich. Dabei weitet sich die linke Herzkammer ballonartig auf und die Betroffenen leiden unter ähnlichen Symptomen wie bei einem Myokardinfarkt. Der Zusammenhang mit akuten psychischen oder physischen Belastungssituationen sowie der Anstieg der Katecholaminkonzentrationen im Serum deuten darauf hin, dass das TTS auf dem Boden einer unphysiologischen Stressreaktion entsteht. Allerdings lässt sich in rund 30 % der Fälle kein Auslöser feststellen. Und bei etwa 12 % der TTS-Patientinnen und -Patienten kommt es innerhalb von fünf Jahren zu einem Rezidiv.
Dr. Leithäuser erinnert in diesem Kontext daran, dass manche Personen ihren Stress nicht bewusst wahrnehmen oder ihn leugnen. In der Anamnese sei daher Aufmerksamkeit gefragt. Belastungssituationen, die in ähnlicher Weise wiederholt auftreten, können die Grenze zwischen einem „normalen Leben“ und wiederkehrendem Stress verschieben.
Auch Patientinnen und Patienten nach einem akuten Myokardinfarkt geben häufig an, einen möglichen Auslöser identifizieren zu können. Einer prospektiven Beobachtungsstudie zufolge hielten 25 % emotionalen Stress und 11 % körperliche Anstrengung für einen Trigger. Zudem weisen Studienergebnisse darauf hin, dass nach der Akutsituation anhaltender Stress das Risiko für wiederholte klinische Ereignisse bei koronarer Herzerkrankung um 55 % erhöht.
Eine rezidivierende Depression im Sinne einer Fehlanpassung des Individuums an anhaltenden Stress gilt als gesicherter episodischer Risikofaktor bei Menschen mit KHK, Herzinsuffizienz und/oder implantierbarem Kardioverter-Defibrillator (ICD), betont Dr. Leithäuser. Umgekehrt können Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Depression hervorrufen. Dadurch entsteht häufig ein Teufelskreis.
Mit der Schwere der Depression steigt das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse und Tod, während die Lebensqualität sinkt. Als Beispiel nennt der Autor ICD-Trägerinnen und -Träger: Über ein Viertel leidet zwei Jahre nach der Implantation an Depressionen. Gleichzeitig sind anhaltend negative Affekte mit einer erhöhten Inzidenz ventrikulärer Arrhythmien verbunden. Mittel- bis langfristige psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz führen ebenfalls zu einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Leiden. Skandinavischen Daten zufolge steigt die Erkrankungshäufigkeit bei Mobbing um 59 %, bei körperlicher Gewalt oder Gewaltandrohung am Arbeitsplatz um 25 %. Dr. Leithäuser plädiert daher dafür, Mobbing und Gewalt als neue potenziell veränderbare kardiovaskuläre Risikofaktoren zu betrachten.
Traumatische Kindheit begünstigt Vorhofflimmern
Zu berücksichtigen seien auch aversive Kindheitserfahrungen. Zwischen der Gesamtbelastung in der Kindheit und dem Herz-Kreislauf-Risiko im Erwachsenenalter gibt es eine Dosis-Wirkungs-Beziehung. In einer Kohortenstudie aus Großbritannien fand sich eine Assoziation zwischen Misshandlungen und dem Auftreten von Rhythmusstörungen wie Vorhofflimmern. Darüber hinaus können traumatische Kindheitserlebnisse eine mangelnde Therapieadhärenz begünstigen.
Quelle: Leithäuser B. Hamburger Ärzteblatt 2025;
79: 12-16


