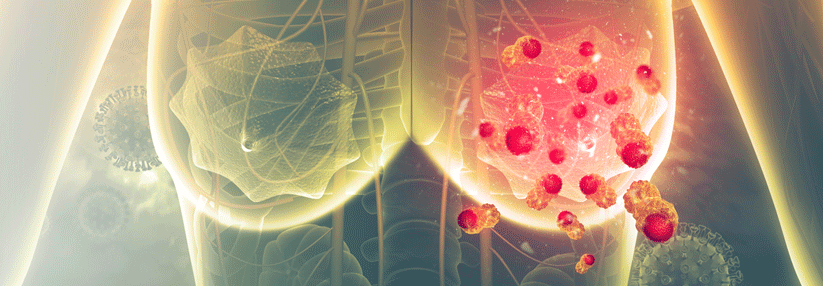MS-Detektion: MRT statt Liquorpunktion? Zentrales Venenzeichen im MRT als neue Diagnostikoption
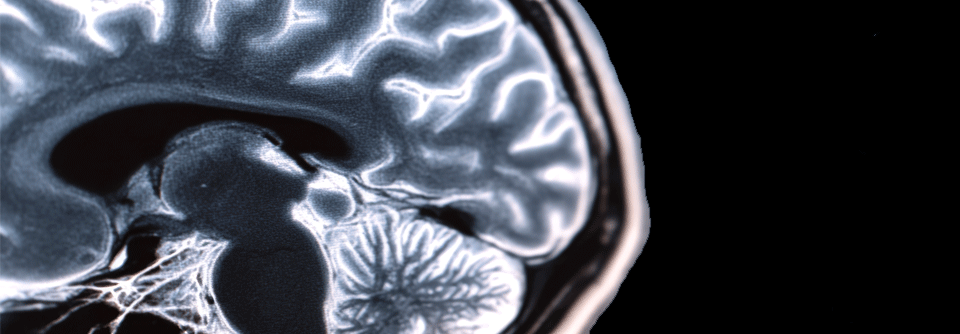 Das zentrale Venenzeichen im MRT zeigt in der MS-Diagnostik eine vergleichbare Sensitivität wie oligoklonale Banden
© Di - stock.adobe.com
Das zentrale Venenzeichen im MRT zeigt in der MS-Diagnostik eine vergleichbare Sensitivität wie oligoklonale Banden
© Di - stock.adobe.com
Bisher wird die Multiple Sklerose (MS) bei typischen Zeichen eines klinisch isolierten Syndroms mit der Detektion oligoklonaler Banden gesichert. Der Nachteil: Man benötigt eine Liquorpunktion. Eine schonende Alternative könnte das zentrale Venenzeichen bieten, d. h. der Nachweis von Venen oder Venolen innerhalb der zerebralen Läsionen. Dafür genügt eine MRT mit T2-gewichteter Sequenz. Vereinfachen lässt sich die Diagnostik mit Hilfe der „Rule of Six“, d. h. mit dem Auffinden von sechs Läsionen mit zentraler Venole. Eine Forschungsgruppe um Dr. Christopher Allen von der Universität Nottingham untersuchte nun, ob der T2-gewichtete MRT-Scan bei typischer Klinik sensitiver ist als die oligoklonalen Banden.
An der Studie nahmen Patientinnen und Patienten teil, die eine Lumbalpunktion benötigten, um die diagnostischen Kriterien für die MS zu erfüllen. Das zentrale Venenzeichen wurde mittels einer sechsminütigen MRT ermittelt. Von den 113 Teilnehmenden unterzogen sich 99 beiden Untersuchungen, bei 80 wurde eine MS diagnostiziert. In zehn Fällen blieb es bei der Einstufung „klinisch isoliertes Syndrom“, acht hatten eine andere Erkrankung und einer blieb ohne Diagnose. Hinsichtlich der Sensitivität ließ sich keine Differenz feststellen. Nebenwirkungen berichteten 75 % der Lumbalpunktierten und 9 % im MRT-Kollektiv, alle bevorzugten die MRT.
Demnach besitzen Venenzeichen und oligoklonale Banden beim klassischen klinisch isolierten Syndrom eine ebenbürtige Sensitivität. Die MRT ist jedoch sicherer und wird besser toleriert. Weitere Studien müssen die Spezifität des Venenzeichens eruieren, vor allem bei Erkrankten ohne typische Klinik.
Zudem müsse man die Aussagekraft bei heterogeneren Populationen, größeren Altersdifferenzen im Kollektiv und Nicht-MS-Diagnosen prüfen, fordern Dr. Alessandro Cagol und Prof. Dr. Dr. Cristina Granziera vom Universitätsspital Basel. Auch der Stellenwert von Biomarkern ist zu klären. Ihr Nachweis könnte eine weitere Alternative zu oligoklonalen Banden bieten.
Quelle: 1. Allen CM et al. Neurol Open Access 2025; doi: 10.1212/WN9.0000000000000017
2. Cagol A, Granziera C. Neurol Open Assess 2025; doi: 10.1212/WN9.0000000000000021