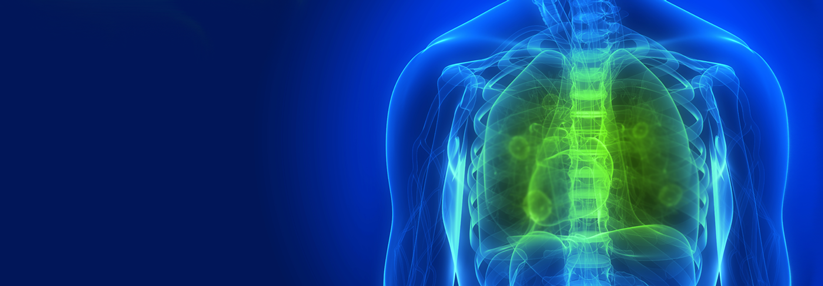Fortschritt in der Pneumonie-Diagnostik CAP-Diagnose: ULD-CT und PCR liefern Vorteile
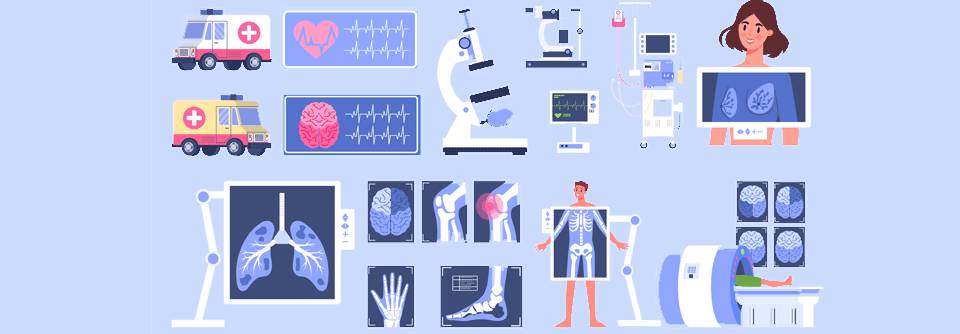 Neue Bildgebungs- und Labortechniken haben die Diagnosegenauigkeit bei ambulant erworbener Pneumonie deutlich gesteigert.
© inspiring.team - stock.adobe.com
Neue Bildgebungs- und Labortechniken haben die Diagnosegenauigkeit bei ambulant erworbener Pneumonie deutlich gesteigert.
© inspiring.team - stock.adobe.com
Eine ambulant erworbene Pneumonie zu erkennen und zu behandeln, ist nicht immer leicht. Die Ultra-Low-Dose-CT und die Multiplex-PCR sollen dazu beitragen, die Treffsicherheit zu erhöhen.
Die Diagnose einer ambulant erworbenen Pneumonie (CAP) fußt nach wie vor auf klinischen Symptomen plus dem röntgenologischen Nachweis von Infiltraten. In unklaren Fällen kommt auch die CT zum Einsatz. Die Zukunft der Bildgebung könnte jedoch zumindest für Risikogruppen wie Immunsupprimierte in der Ultra-Low-Dose-CT (ULD-CT) liegen. Das Verfahren ermöglicht eine präzise thorakale Bildgebung bei Strahlendosen im Bereich einer konventionellen Röntgenaufnahme, berichtete die in Hamburg-Harburg niedergelassene Pneumologin Prof. Dr. Jessica Rademacher.
In einer Studie der Medizinischen Hochschule Hannover an 27 Patientinnen und Patienten mit Pneumonieverdacht änderte sich in 41 % der Fälle durch die ULD-CT die Diagnose. In 37 % wurde die therapeutische Strategie korrigiert. Bei zehn Erkrankten – darunter Immunsupprimierte – konnte mit der Methode ein Infiltrat sicher ausgeschlossen werden. Nur in zwei Fällen war dann doch eine Computertomografie mit Kontrastmittelgabe erforderlich.
Analyse des Aspirats benötigt nur zwei Stunden
Ein weiteres neues Diagnoseverfahren ist die Multiplex-PCR zum schnellen Erregernachweis. Welche Vorteile sie im Setting einer pädiatrischen Notaufnahme bietet, haben Forschende aus Frankreich bei 499 jungen Patientinnen und Patienten im Alter zwischen drei Monaten und 18 Jahren geprüft. Alle litten unter Fieber und zeigten radiologische Hinweise auf eine Pneumonie. Bei der Hälfte von ihnen führte man eine Multiplex-PCR aus nasopharyngealem Aspirat durch, deren Ergebnis innerhalb von zwei Stunden vorlag. Die übrigen erhielten die standardmäßige antibiotische Behandlung.
Als primärer Endpunkt war die zielgerichtete Initialtherapie definiert. Sie fand nach dem Urteil eines unabhängigen Expertengremiums in der PCR-Gruppe signifikant häufiger (68,6 % vs. 48,2 %) statt. Unnötige Antibiotikagaben bei viraler Pneumonie erfolgten deutlich seltener (41,4 % vs. 80,8 %). In der PCR-Gruppe wurden mehr Patientinnen und Patienten stationär aufgenommen. Kein Unterschied zeigte sich in der Dauer des Krankenhausaufenthalts und der Therapieanpassung im Verlauf.
In einer Studie mit 374 Erwachsenen, bei denen in der Ambulanz der Verdacht auf eine CAP bestand, wurde der primäre Endpunkt – pathogenbasierte Therapie innerhalb von 48 Stunden – in der PCR-Gruppe zu 35,3 %, in der Vergleichsgruppe zu 13,4 % erreicht. Die niedrige Erfolgsrate ist dem Umstand geschuldet, dass sich der Pneumonieverdacht letztlich nur bei 56 % der Kranken bestätigte, sagte Prof. Rademacher. Die Zeit bis zur zielgerichteten Behandlung wurde infolge der PCR-Diagnostik von 43,8 h auf 34,5 h verkürzt. In den harten Endpunkten (Letalität, Krankenhausverweildauer) zeigte sich aber kein Unterschied, betonte die Pneumologin.
Insbesondere bei negativer Kultur steigt die Diagnosesicherheit durch die Multiplex-PCR. Vor allem virale und atypische Erreger können schneller identifiziert werden, was eine raschere gezielte Therapie ermöglicht. Kritiker warnen jedoch davor, die Aussagekraft des Verfahrens zu überschätzen. Die Ergebnisse zu interpretieren könne bei mangelnder Erfahrung schwierig sein. Schließlich ist nicht jeder Erreger, der nachgewiesen wird, tatsächlich für das vorliegende Krankheitsbild verantwortlich. Außerdem fehlen für klinisch harte Endpunkte die positiven Studien.
Quelle: Infektiologie-Update-Seminar 2025