
Evidenz mit Lücken? Darum sollten Frauen und Männer unterschiedlich behandelt werden
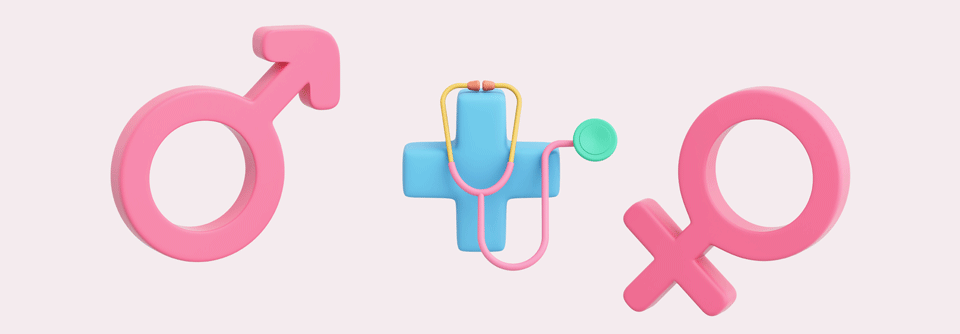 Es gebe geschlechtsspezifische Unterschiede in der Epidemiologie, aber auch in der Behandlung, erläuterte Dr. Maike Trommer im Interview.
© chawalit – stock.adobe.com
Es gebe geschlechtsspezifische Unterschiede in der Epidemiologie, aber auch in der Behandlung, erläuterte Dr. Maike Trommer im Interview.
© chawalit – stock.adobe.com
Mit der Projektidee müsste eigentlich klar sein: Wie sind die Diversitätskriterien? Haben wir das alles erfüllt?“, betont Dr. Maike Trommer, Universitätsklinik Bonn und Uniklinik Köln, auf die Frage nach Verbesserungspotenzial rund um Studiendesigns für eine geschlechtergerechtere Medizin. Nur so könne sichergestellt werden, dass ausreichend Frauen und Randgruppen in Studien eingeschlossen werden. Und das wiederum sei notwendig, um allen adäquate Behandlungsoptionen anbieten zu können.
Ein Beispiel: Das nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom
Männer sind generell häufiger von NSCLC betroffen und ihre Prognose ist schlechter als die von Frauen. Zudem weicht die Verteilung der Histologietypen voneinander ab. Wie eine Real-World-Datenanalyse darlegen konnte, werden Frauen und Männer mit NSCLC auch unterschiedlich behandelt, erläuterte Dr. Trommer im Interview. Beispielsweise erhalten Männer mehr Therapiemodalitäten und diese beinhalten häufiger eine Immuntherapie. „In den klinischen Outcomes haben wir gesehen, dass die Frauen trotzdem bessere Remissionsraten haben“, so die Radioonkologin. Es gebe also geschlechtsspezifische Unterschiede in der Epidemiologie, aber auch in der Behandlung.
Geschlechtsabhängige Leitlinienempfehlungen gibt es allerdings nicht. Auch nicht für andere Entitäten, gab Dr. Trommer zu bedenken. Das Ziel sei deshalb herauszufinden, ob die Unterschiede möglicherweise in Leitlinien aufgenommen werden sollten und ob geschlechtsspezifische Empfehlungen ausgesprochen werden müssen, erläuterte die Expertin.
Quelle: Kongressinterview, Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie 2025


