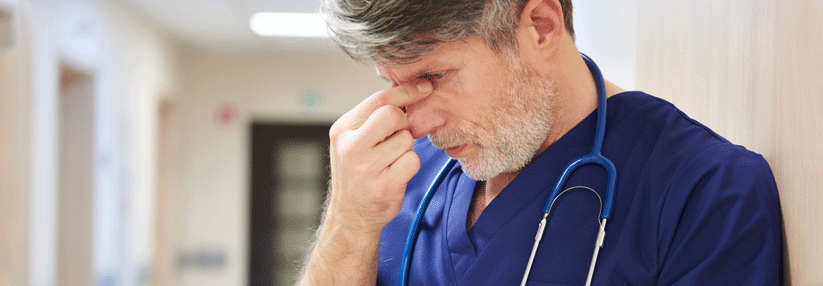Mord in der Pflege Den Todesengeln auf der Spur
 Der Tod der Opfer kam fast immer überraschend.
© Gorodenkoff- stock.adobe.com
Der Tod der Opfer kam fast immer überraschend.
© Gorodenkoff- stock.adobe.com
Was treibt einen Pfleger oder eine Pflegerin dazu, Heimbewohner und Patienten gegen deren Willen zu töten? Und wie kommt es, dass die Täter über Monate und Jahre hinweg teils Dutzende Morde begehen, ohne dass Kollegen und Vorgesetzte Verdacht schöpfen oder etwas unternehmen? Diesen Fragen ist Prof. em. Dr. Karl Beine, bis 2019 Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Witten/Herdecke, nachgegangen. Er untersuchte alle bis Februar 2022 in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem rechtskräftigen Urteil abgeschlossenen Tötungsserien in Kliniken und Heimen.
Anhand von Gerichtsunterlagen und eigenen Prozessbeobachtungen wertete der Psychiater zwölf Serien mit insgesamt 205 Tötungen aus. Die umfangreichste Serie umfasste allein 87 Fälle. Das jüngte Opfer war 31 Jahre alt, das älteste 96. Die 17 Täter waren allesamt Pflegekräfte, mit einem ausgeglichenen Verhältnis von Männern zu Frauen. Keiner der Täter war nach eigener Aussage auf sein Handeln angesprochen worden – die meisten von ihnen gingen jedoch davon aus, dass man im Team um ihr Tun gewusst und es stillschweigend gebilligt habe.
Selbstunsicherheit und Machtstreben
Alle Täter zeichneten sich durch Selbstunsicherheit aus, aber auch durch Geltungsdrang und Machtstreben. In vielen Fällen hatten sie sich vor oder während der Tötungsserien von Kollegen, Familie und Freunden zurückgezogen. Offensichtlich hatten sie mit der Zeit jegliche Empathie gegenüber ihren Schützlingen verloren: Befragte Kollegen berichteten von zunehmend zynischen bis groben Äußerungen, charakterisierten die Beschuldigten als aufbrausend und aggressiv. Alle Täter bis auf zwei galten nach psychiatrischem Gutachten als voll schuldfähig.
Als Motiv gaben einige an, der Nervenkitzel eines so gravierenden Verbrechens habe sie gereizt. Andere sagten, sie hätten Mitleid mit ihren Opfern verspürt, da sich diese ja in ausweglosen Situationen befunden hätten. Tatsächlich aber hatten nur wenige der Getöteten im Sterben gelegen, einige standen kurz vor der Entlassung. Ihr Tod kam deshalb fast immer überraschend. Im Zuge der Gerichtsverhandlungen sei deutlich geworden, dass sich die Täter in aller Regel eine emotionale Entlastung oder eine Aufwertung in den Augen ihrer Kollegen erhofft hatten, so Prof. Beine.
Viele der Zeugen gaben vor Gericht an, schon früh misstrauisch geworden zu sein. So waren die Angeklagten auffallend häufig beim Tod von Patienten oder bei lebensbedrohenden Notfällen zugegen gewesen. Manche hatten sogar interne Spitznamen wie „Hexe“ oder „Todesengel“ verpasst bekommen – dem Psychiater zufolge ein eindeutiges Warnsignal. Dennoch hatte niemand angemessen reagiert: Weil Kollegen oder Vorgesetzten die Situation falsch einschätzten, sie persönliche Nachteile befürchteten oder um das Ansehen ihrer Einrichtung besorgt waren.
Auffallend war die oft unzureichende Personalausstattung der Heime oder Kliniken. Die Vorgesetzten schienen den Mitarbeitern häufig wenig greifbar; innerhalb der Teams hatten mitunter langjährige Konflikte geschwelt. Das habe die Frustration der Täter weiter befeuert.
Quelle: Beine KH. Dtsch Med Wochenschr 2022; DOI: 10.1055/a-1899-7344