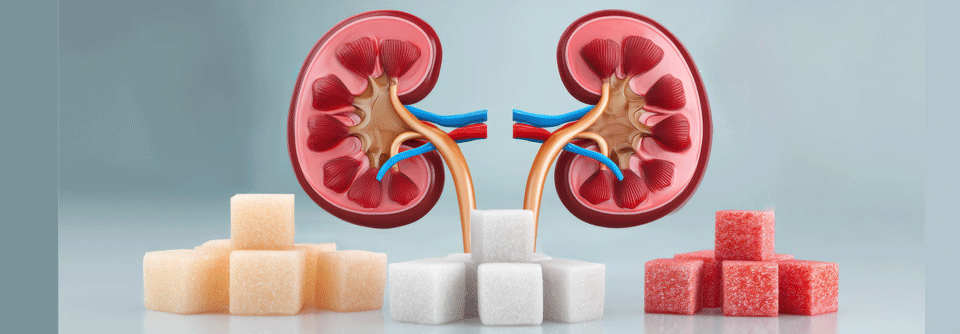Neue Technik, früheres Screening? Diabetes während der Schwangerschaft im Griff
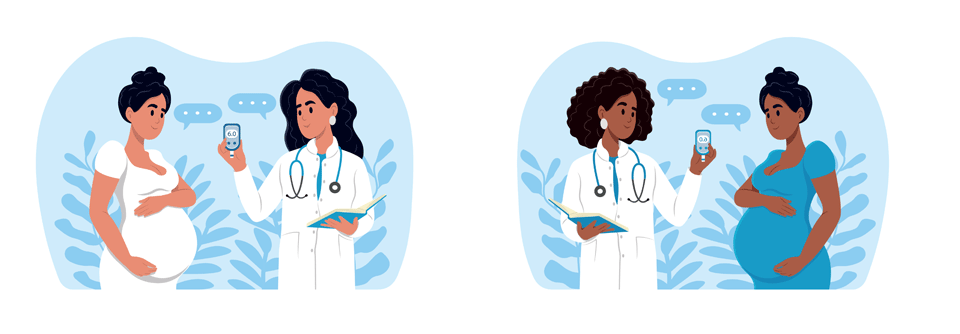 Schwangerschaft und Diabetes treffen häufig aufeinander
© Nadiia - stock.adobe.com
Schwangerschaft und Diabetes treffen häufig aufeinander
© Nadiia - stock.adobe.com
Von rund 664.000 Schwangerschaften in Deutschland im Jahr 2023 wurde bei 8,5 % ein Diabetes mellitus beobachtet. 7.587 der Frauen (1,14 %) wiesen einen vorbestehenden Diabetes auf (alle Typen); 49.188 (7,41 %) entwickelten einen Gestationsdiabetes, berichtet PD Dr. Katharina Laubner vom Universitätsklinikum Freiburg. Damit hat sich der Anteil der Schwangeren mit Diabetes in den vergangenen 20 Jahren stark erhöht. Das liegt vor allem an der Zunahme des Gestationsdiabetes, auch wenn bei diesem nach langem Anstieg aktuell eine Stagnation der Fallzahlen zu beobachten ist. Unabhängig vom Erkrankungstyp stellt sich aber bei jeder Patientin die Frage nach dem optimalen Therapiemanagement.
Automatisierte Insulindosierung bei Schwangeren mit Typ 1
Automatisierte Insulindosierungssysteme (AID-Systeme) sind generell dafür bekannt, bei Menschen mit Diabetes Typ 1 die Glukosekontrolle zu verbessern. Daher liegt es nahe, sie auch bei Schwangeren einzusetzen. Derzeit besitzt aber nur der CamAPS FX-Algorithmus eine CE-Zertifizierung für die Schwangerschaft, weil er eine Anpassung des Zielwerts auf < 100 mg/dl (5,5 mmol/l) erlaubt.
In der AiDAPT-Studie befanden sich die Schwangeren damit (plus CGM-System und Pumpe) von der 16. Schwangerschaftswoche bis zur Geburt pro Tag ca. 2,5–3 h länger im Zielbereich (63–140 mg/dl bzw. 3,5–7,8 mmol/l) im Vergleich zum herkömmlichen Vorgehen. Dieses bestand aus der Berechnung der benötigten Insulinmenge auf Basis der CGM-Messung durch die Schwangere und anschließender Applikation mittels Pumpe bzw. manuell.
Hinsichtlich Ketoazidosen oder schwerer Hypoglykämien unterschieden sich die Gruppen nicht. Die Frauen selbst empfanden das AID-System als angenehmer. Auch weitere aktuelle Untersuchungen mit anderen Systemen kamen übereinstimmend zu dem Schluss, dass AID-Systeme für die Aufrechterhaltung einer strengen glykämischen Kontrolle bei Schwangeren geeignet und sicher sind, so Dr. Laubner.
Inkretinmimetika in der Frühschwangerschaft
Die Nutzung von Inkretinmimetika nimmt zu, sei es zur Behandlung eines Typ-2-Diabetes oder aufgrund von Adipositas. Das gilt auch für junge Frauen im reproduktionsfähigen Alter. Eine Gewichtsreduktion mit reduzierter Insulinresistenz fördert oft die Fertilität, so könnte es zu mehr ungeplanten Schwangerschaften kommen.
2024 wurden zwei Studien veröffentlicht, die die Möglichkeit eines teratogenen Risikos von Inkretinmimetika beleuchteten. Beide kamen zu dem Ergebnis, dass nach Exposition in der Frühschwangerschaft keine vermehrten lebensbedrohlichen Fehlbildungen bei Neugeborenen auftraten. Da bislang aber keinerlei Daten zu weiteren Risiken wie beispielsweise späteren metabolischen Erkrankungen bei den Kindern vorliegen, wird von der Autorin ausdrücklich empfohlen, Inkretinmimetika bei Kinderwunsch bzw. sobald eine Schwangerschaft festgestellt wird, abzusetzen.
Diagnostik des Gestationsdiabetes
Der orale Glukosetoleranztest auf einen möglichen Gestationsdiabetes gehört zu den Routineuntersuchungen zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche. In einer Studie wurde die Testung (75 g) im Fall von vorliegenden Risikofaktoren bereits vor der 20. Woche durchgeführt. Die frühe Diagnose und Behandlung erwiesen sich mit Blick auf verschiedene schwerwiegende Folgen für das Neugeborene als etwas günstiger. Wie sich herausstellte, ließ sich allerdings bei etwa einem Drittel die frühe Diagnose zum späteren Routinetermin nicht bestätigen. Wann genau und wie getestet werden sollte und wer genau als Risikopatientin definiert werden sollte, sei daher weiterhin nicht ganz klar, merkt Dr. Laubner einschränkend an.
In einer weiteren Untersuchung zur früheren Diagnose des Gestationsdiabetes wurden Frauen bereits in der Frühschwangerschaft mit einem CGM ausgestattet. Dabei zeigte sich, dass Frauen mit höheren Zuckerspiegeln in der frühen Schwangerschaft häufiger einen Gestationsdiabetes entwickelten. Aufgrund des erhöhten Risikos für einen Typ-2-Diabetes wird für alle Frauen mit Gestationsdiabetes sechs bis zwölf Wochen nach der Entbindung erneut ein oraler Toleranztest empfohlen – allerdings nimmt nur etwa ein Drittel dieses Angebot wahr.
Einer ersten Analyse zufolge könnten sich klinische Daten und Laborergebnisse aus der Schwangerschaft als Prädiktoren eignen, um eine Gefährdung vorherzusagen. Sollten sich diese Ergebnisse bestätigen, würde es in Zukunft ausreichen, risikoadaptiert nur diese Personen zu testen.
Quelle: Laubner K. Diabetologie 2025; 21: 578-587; doi: 10.1007/s11428-025-01354-6ung
Mehr zum O-Ton Diabetologie
Den Podcast O-Ton Diabetologie gibt es alle 14 Tage mittwochs auf den gängigen Podcast-Plattformen. Hier sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Diabetologie über neue Diabetestechnologien und Behandlungsformen, aktuelle Forschungsergebnisse und Leitlinienupdates, Reizthemen der Gesundheitspolitik und der Digitalisierung.