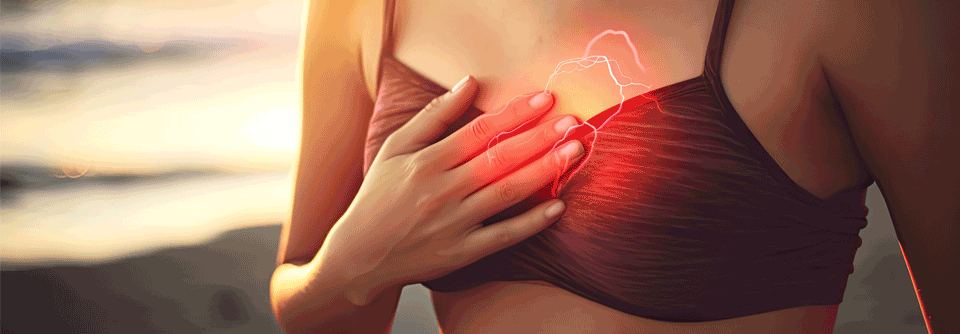Jeder Vierte wird herzinsuffizient Europäische Daten beleuchten den Stellenwert von acht modifizierbaren Risikofaktoren
 Die Herzinsuffizienz gilt als die kardiovaskuläre Epidemie des 21. Jahrhunderts.
© anatoliycherkas - stock.adobe.com
Die Herzinsuffizienz gilt als die kardiovaskuläre Epidemie des 21. Jahrhunderts.
© anatoliycherkas - stock.adobe.com
Männer haben ein höheres Lebenszeitrisiko für eine Herzinsuffizienz mit reduzierter, Frauen dagegen für eine Herzinsuffizienz mit erhaltener linksventrikulärer Ejektionsfraktion (HFrEF bzw. HFpEF). Das berichtet ein Forscherteam um Prof. Dr. Bart van Essen von der Universität Groningen nach Auswertung von Langzeitdaten der PREVEND-Studie. Das Analysekollektiv umfasste 8.558 Einwohnerinnen und Einwohner der niederländischen Stadt Groningen, die zwischen 1997 und 1998 in die Kohorte eingeschlossen worden waren. Nun prüften die Forschenden, wie viele Personen bis 2022 eine Herzinsuffizienz entwickelt hatten. Eine HFrEF lag per Definition bei einer linksventrikulären EF < 50 %, eine HFpEF dagegen bei einer linksventrikulären EF ≥ 50 % vor. Weiterhin interessierte die Arbeitsgruppe, welchen Einfluss folgende acht Risikofaktoren auf die Erkrankungswahrscheinlichkeit haben: Hypertonie, Adipositas, Diabetes Typ 2, Hypercholesterinämie, Rauchen, Vorhofflimmern, Myokardinfarkt und chronische Niereninsuffizienz.
Das Geschlechterverhältnis war in der Kohorte ausgewogen. Während median 23,4 Jahren Nachbeobachtungszeit entwickelten 534 Personen eine HFrEF und 270 eine HFpEF. Bei der Diagnose Herzinsuffizienz waren Männer im Schnitt 72 und Frauen 74 Jahre alt. Das Lebenszeitrisiko für eine Herzinsuffizienz betrug für Männer rund 25 % und für Frauen 23 %. Bezüglich des Lebenszeitrisikos für eine HFrEF waren die Frauen im Vorteil (12 % vs. 18 %), bezüglich des Lebenszeitrisikos für eine HFpEF dagegen die Männer (6 % vs. 12 %).
Bei beiden Geschlechtern hatten die genannten Risikofaktoren einen großen Anteil an der Entwicklung einer Herzinsuffizienz: Bei den Frauen waren 71 % der neu aufgetretenen HFrEF- und 64 % der HFpEF-Fälle darauf zurückzuführen, bei den Männern 60 % bzw. 46 % der HFrEF- bzw. HFpEF-Fälle. Den stärksten Einfluss auf das HFrEF-Risiko hatten sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Hypertonie und die Hypercholesterinämie. Bezüglich der HFpEF erwiesen sich bei beiden Geschlechtern Bluthochdruck und Adipositas als stärkste Risikofaktoren. Angesichts dieser Beobachtungen geht Prof. van Essen davon aus, dass sich durch ein gezieltes Screening auf die genannten acht potenziell – direkt oder indirekt – modifizierbaren Risikofaktoren sowie eine entsprechende Therapie das Herzinsuffizienzrisiko deutlich senken lässt.
Quelle: van Essen BJ et al. Eur Heart J 2025; 46: 1528–1536; doi: 10.1093/eurheartj/ehae868