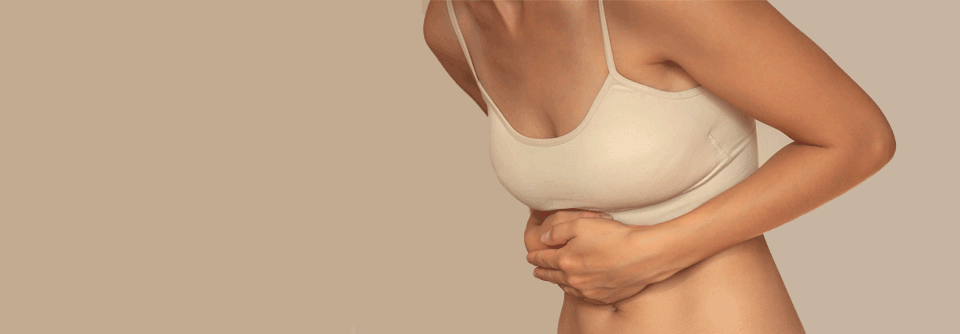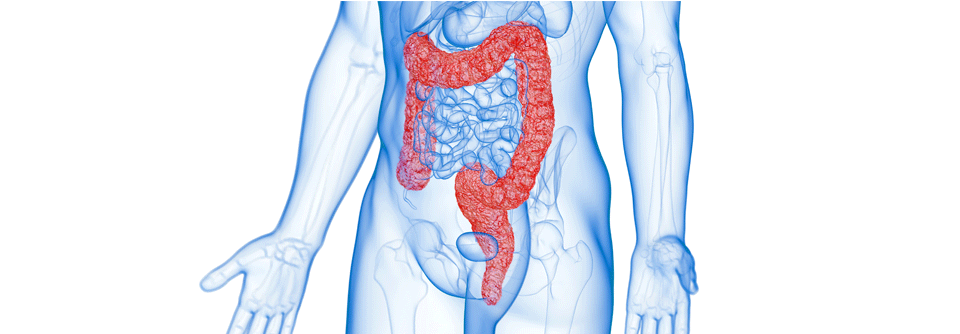
Beenden der Dauermedikation Exitstrategie aus der Endlostherapie
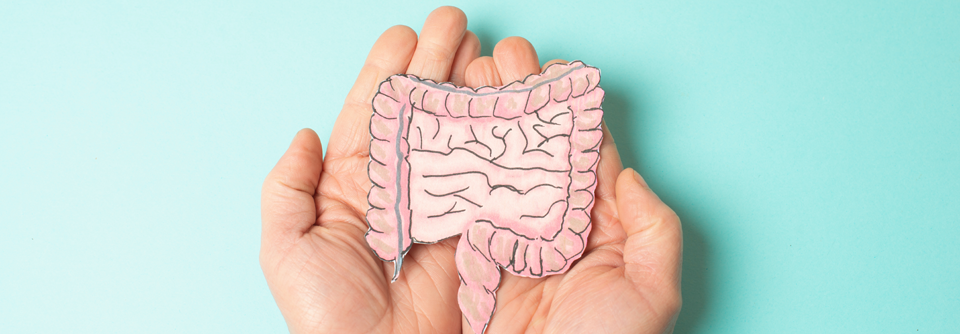 Morbus-Crohn-Erkrankte auf dem Prüfstand: Wie gelingt nach erfolgreicher Remission das Absetzten der Dauermedikation?
© Berit Kessler – stock.adobe.com
Morbus-Crohn-Erkrankte auf dem Prüfstand: Wie gelingt nach erfolgreicher Remission das Absetzten der Dauermedikation?
© Berit Kessler – stock.adobe.com
Die Mutter aller Exitstrategien sei die Chirurgie. Das sagte Prof. Dr. Ulf Helwig, niedergelassener Gastroenterologe in Oldenburg. Er zeigte anhand von Langzeitdaten einer retrospektiven Follow-up-Studie aus den Niederlanden, dass 22 % der Morbus-Crohn-Patientinnen und -Patienten, die sich einer Darmresektion unterzogen hatten, danach ohne weitere Behandlung auskamen. „Es gilt deshalb, diese Patienten ausfindig zu machen“, so der Referent. Als Prädiktoren für ein Rezidiv sind laut einer Studie aus Israel unter anderem eine kurze Behandlungs- sowie Remissionsdauer und multiple Biologikavortherapien zu werten.
Ein messbarer prospektiver Faktor für einen medikationsfreien Remissionserhalt bei CED ist das Nichtvorhandensein von therapeutischen Spiegeln des Medikaments. Dies demonstrierte eine retrospektive Datenanalyse aus Israel, in der der Therapieerfolg unter Infliximab bzw. Adalimumab mit den gemessenen Wirkspiegeln abgeglichen wurde. Die Studienautorinnen und -autoren kamen zu dem Ergebnis: Wenn unter Remission keine Spiegel mehr nachgewiesen werden können, kommt die Patientin bzw. der Patient auch ohne den Wirkstoff aus. Sind dagegen noch volle Spiegel nachweisbar, wird das Medikament weiterhin benötigt.
Diese Annahme stellten Prof. Helwig und sein Team in einer eigenen Studie mit Morbus-Crohn- und Colitis-ulcerosa-Erkrankten auf den Prüfstand. Sie filterten jene heraus, die unter Anti-TNF-Medikation eine klinische Remission erreichten und deren Wirkspiegel unter der Nachweisgrenze lagen. Konnte das Ärzteteam einen Therapiestopp aufgrund der Vorgeschichte und der Entzündungskonstellation vertreten, wurde die Medikation abgesetzt. Es zeigte sich, dass die Rückfallraten deutlich geringer waren, wenn man diesem Algorithmus folgte. Prof. Helwig erwähnte aber auch, dass die Datenlage zu diesem Vorgehen noch recht gering ist. Grundvoraussetzung für das Gelingen einer Exitstrategie, deren Entscheidung auf der Höhe der Wirkspiegel beruht, sei die klinische und laborchemisch-endoskopische Remission.
Der Referent berichtete von einer prospektiven, multizentrischen Real-World-Beobachtungsstudie aus Frankreich, deren Publikation bald erwartet wird. Die dort untersuchten Morbus-Crohn-Erkrankten hatten eine kurze mediane Erkrankungsdauer von vier Monaten, als eine First-Line-Therapie mit Adalimumab begonnen wurde. Nach einem Jahr befanden sich 30 % der Teilnehmenden in tiefer Remission – die Bedingung dafür, dass Adalimumab abgesetzt wurde. Knapp 44 % dieses Patientenkollektivs erreichte den primären Endpunkt, nämlich eine anhaltende Remission über zwölf Monate nach Absetzen des Immunmodulators. Ein relevanter Anteil profitierte demnach von einem Therapieende, wenn nach sehr frühem Behandlungsbeginn eine Remission erreicht wurde. Dennoch ist diese Strategie laut Prof. Helwig aufgrund der trotzdem noch recht hohen Rückfallrate umstritten. Er betonte auch hier, dass nur Personen in klinischer und laborchemisch-endoskopischer Remission dafür infrage kommen.
Weitere Parameter helfen dabei, das individuelle Rückfallrisiko einzuschätzen. Die Ergebnisse der PROGNOS-Studie haben Kriterien für die Prognose eines leichten Verlaufs bei Morbus Crohn hervorgebracht. Hierzu gehören:
- Alter > 40 Jahre
- niedriges CRP (2–4 mg/l)
- keine Läsionen laut endoskopischem Score
- keine perianalen Läsionen
- keine Komplikationen (z. B. Stenosen oder Fisteln)
Patientinnen und Patienten die diesen Kriterien entsprechen, sind laut Prof. Helwig auch jene, bei denen man am ehesten über ein Therapieende nachdenken könne. Daten, die das explizit belegen, gebe es bislang jedoch keine.
Aus mehreren Morbus-Crohn-Studien zusammengetragen wurden ebenfalls Kriterien, die einen schweren Krankheitsverlauf prognostizieren und eine erfolgreiche Exitstrategie damit unwahrscheinlicher machen. Für einen schweren Verlauf sprechen:
- Alter ≤ 40 Jahre
- ausgeprägter Befall > 100 cm
- Befall des oberen gastrointestinalen Traktes
- Raucher
- perianaler Befall
- intraabdominelle Fisteln
- Steroidgebrauch bei erstem Schub
- Gewichtsverlust > 5 kg
- Fieber
- Anämie bei Erstmanifestation
All diese Kriterien für die Beurteilung von Wahrscheinlichkeit und Schwere eines möglichen Rezidivs sollten unbedingt in die Entscheidung für oder gegen das Absetzen der Medikation einfließen. Das sei eine multifaktorielle Entscheidung, bei der die ganz individuelle Risikokonstellation der Betroffenen bestimmt werden müsse, so Prof. Helwig.
Der Referent riet zu einer engmaschigen Überwachung. „Uns muss klar sein, dass wir mit der Exitstrategie ein heißes Eisen anfassen“, so der Gastroenterologe. Die Betroffenen würden natürlich Gefahr laufen, ein Rezidiv zu erleiden, und dann sollten alle Beteiligten schnell handlungsfähig sein. Im besten Fall wird schon vorher festgelegt, wie das Vorgehen aussehen soll und welche Therapie dann zum Einsatz kommt.
Quelle: Medical-Tribune-Bericht