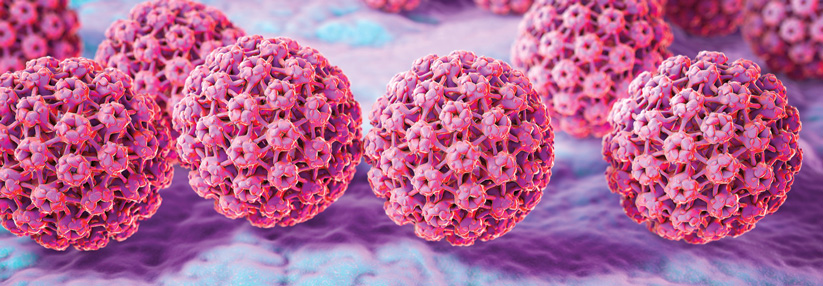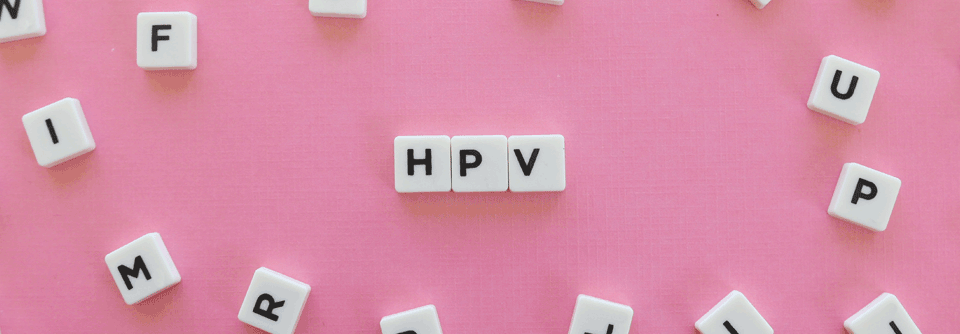
Erhöhtes Krebsrisiko bei HIV HIV-Infizierte unbedingt auf Analkarzinome screenen
 Menschen mit HIV tragen ein bis zu 100-fach erhöhtes Risiko für Analkarzinome.
© Konstantin Yuganov - stock.adobe.com
Menschen mit HIV tragen ein bis zu 100-fach erhöhtes Risiko für Analkarzinome.
© Konstantin Yuganov - stock.adobe.com
Menschen mit HIV tragen ein bis zu 100-fach erhöhtes Risiko für Analkarzinome. Die frühe Diagnose und Therapie von Vorläuferläsionen können diese Gefahr beträchtlich mindern. Wie gelingt dies am besten?
Für Menschen, die mit dem Humanen Immundefizienzvirus (HIV) infiziert sind, empfiehlt das Expertenteam der aktuellen deutsch-österreichischen Leitlinie der DGG* und weiterer Fachgesellschaften ein regelmäßiges Screening auf hochgradige Analdysplasien und Malignome. Die histopathologische Klassifikation unterscheidet zwischen normaler Mukosa, Feigwarzen (Condylomata acuminata), analen intraepithelialen Neoplasien (AIN) der Grade 1 bis 3 und Karzinomen.
Empfohlenes Screening-Alter richtet sich nach Risiko
Zielgruppe für das Screening auf Analkarzinome sind alle Personen ab 45 Jahren, die das HI-Virus tragen. HIV-infizierte Männer, die Sex mit Männern haben, und Transgender-Frauen mit dem Virus, sollen bereits ab einem Alter von 35 Jahren gescreent werden. Menschen mit HIV und schwerer zervikaler, vulvärer oder persistierender analer Dysplasie sollen unabhängig vom Alter auf Analkarzinome untersucht werden, ebenso HIV-Träger mit CD4+-Lymphozyten < 200/µl.
Ein etwas niedrigerer Empfehlungsgrad wurde für Personen mit HIV und persistierenden anogenitalen Warzen sowie für Frauen mit dem Virus und persistierendem HPV16 (> 1 Jahr) ausgesprochen. Für sie wird ein Screening auf Analkarzinome unabhängig vom Alter empfohlen. Das Gleiche gilt für HIV-Infizierte, die eine immunsuppressive Therapie erhalten. Was die Frequenz betrifft, wird in der Leitlinie für alle Patientengruppen für eine Untersuchung mindestens alle zwei Jahre plädiert, vorausgesetzt es bestehen keine Läsionen im Analepithel.
Fest zur Diagnostik gehören Inspektion, digitale rektale Palpation und anale Zytologie. Bei ungewöhnlichen Befunden wird eine genauere Abklärung empfohlen. Dr. David Chromy von der Universitätsklinik für Dermatologie in Wien und seine Arbeitsgruppe raten von einer Analzytologie im Rahmen des Karzinomscreenings ab, wenn in den 24 Stunden davor eine Darmspülung oder rezeptiver Geschlechtsverkehr erfolgte, ebenso bei Verdacht oder Diagnose einer akuten bakteriellen Infektion in der Region. Die zytologische Probe sollte direkt bei der ersten intraanalen Untersuchung gewonnen werden. Das verringert die Gefahr einer späteren Kontamination z. B. mit Blut oder Gleitmittel, die das Ergebnis verfälschen kann. Auch eine Selbstentnahme durch den Betroffenen ist nach entsprechender Instruktion möglich.
Zusätzlich kann eine Untersuchung auf relevante Hochrisikovarianten des Humanen Papillomvirus (HR-HPV) sinnvoll sein. Dessen DNA lässt sich oft bereits detektieren, wenn noch keine Schleimhautläsionen vorliegen. Mikrobiomanalysen im Rahmen von Screenings sollten unterbleiben. Mit der digitalen rektalen Untersuchung lassen sich fünf Parameter erfassen: Sphinktertonus, Schmerzempfindlichkeit, Stenose und Vernarbung, Blut bzw. Mukus und Füllung der Ampulla recti. Sie erfolgt am besten unmittelbar vor der Anoskopie.
Bei Verdacht auf hochgradige Veränderung besser biopsieren
Goldstandard zum Nachweis von Dysplasien ist die hochauflösende Anoskopie (HRA). Dabei soll der gesamte Darmausgang nebst Perianalregion inspiziert werden. Wenn eine hochgradige Veränderung nicht ausgeschlossen werden kann, raten die Autorinnen und Autoren, alle Läsionen zu biopsieren. Eine HRA soll bei atypischen Plattenepithelzellen, niedriggradigen intraepithelialen Läsionen und hochgradigen Läsionen durchgeführt werden. Falls eine HRA nicht zur Verfügung steht, sollte die konventionelle Variante ohne Vergrößerung angeboten werden.
Zur Therapie der histologisch gesicherten hochgradigen Dysplasie wird in der Leitlinie Elektrokauterisation, Trichloressigsäure und operative Exzision empfohlen. Auch C02-Laser, Radiofrequenzablation, Kryotherapie, Infrarotkoagulation und Imiquimod können eingesetzt werden. Die Anwendung von 5-Fluorouracil 5 % und Sinecatechin, sowie photodynamischer Behandlung und Radiotherapie ist ebenfalls möglich. Manche Patientinnen und Patienten profitieren von Kombinationen verschiedener Verfahren. In jedem Fall ist ein sorgfältiges Follow-up erforderlich.
*Deutsche Dermatologische Gesellschaft
Quelle: Chromy D et al. „German-Austrian Guideline on screening for anal dysplasia and anal carcinoma in people living with HIV“; J Dtsch Dermatol Ges. 2025; 8:1025-1040; doi: 10.1111/ddg.15719; AWMF-Register-Nr. 055-007; www.awmf.org