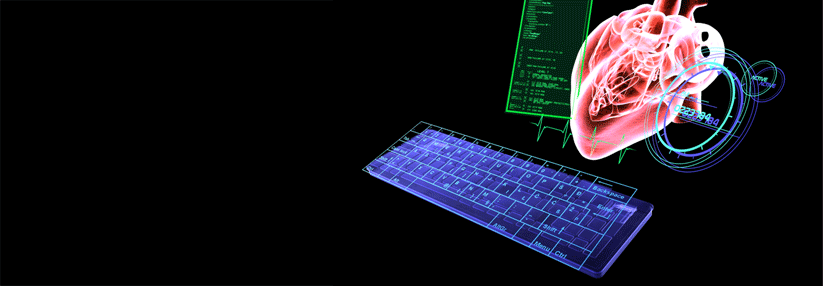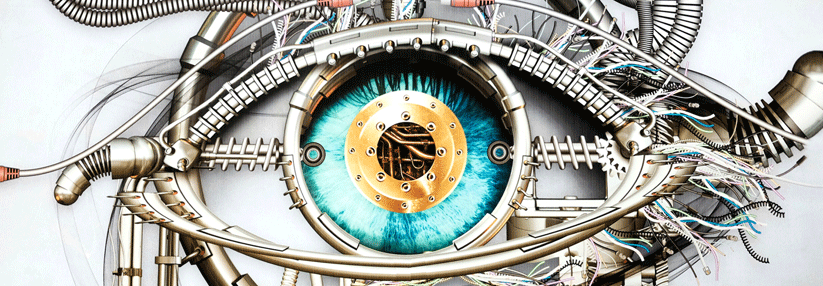Implementierung von KI KI in die Pathologie: Kommunikation ist der Schlüssel
 Die meisten Patholog:innen wünschen sich KI für ihre Labore, doch oft sind Projekte unrentabel.
© krass99 – stock.adobe.com
Die meisten Patholog:innen wünschen sich KI für ihre Labore, doch oft sind Projekte unrentabel.
© krass99 – stock.adobe.com
Rund 200 Patholog:innen in einem Raum – diese Gelegenheit nutzte ein Sprecher bei einer Fachveranstaltung für die Umfrage: „Sind Patholog:innen bereit, KI in der Praxis zu nutzen?“ Die mehrheitliche Antwort darauf lautete natürlich „Ja“, erzählte Prof. Dr. Inti Zlobec von der Universität Bern. Was einen Kollegen dazu veranlasste, später im Gespräch zu fragen: „Wenn Patholog:innen das wollen und die Technologie existiert, warum sind sie dann so langsam bei der
Implementierung von KI?“
„Ich muss sagen, das traf mich ziemlich“, schilderte Prof. Zlobec. „Denn die Wahrheit ist: Nur ein vollständig digitalisiertes Labor kann KI implementieren, ohne dass logistische Probleme entstehen: Woher weiß das Labor, welche Objektträger gescannt werden müssen, welche nicht, welche in die KI-Analyse gehen sollen – völliges Chaos, glauben Sie mir. Wir haben es ausprobiert.“
Es knirscht an den Schnittstellen
In der Schweiz liegt der Anteil der Labore, die vollständig digital sind, allerdings nur bei rund 5 %. „Und mit digital meine ich wirklich papierlos“, stellte die Referentin klar. In Europa sehe es ähnlich aus. Eine solche Umstellung sei schließlich auch ein großes IT-Projekt. Das größte Problem sei dabei die Schnittstelle zwischen den Labor-Informationssystemen (LIS) und den Bildmanagementsystemen (IMS): das Software-Interface (LIS-IMS-KI). „Ehrlich gesagt habe ich es noch nie erlebt, dass das wirklich reibungslos funktioniert“, betonte Prof. Zlobec.
Außerdem könne man nicht einfach ein Labor „digital machen“. Vieles müsse komplett neu aufgebaut werden – nebenher, ohne die Durchlaufzeiten zu ruinieren. „Nicht zu vergessen die Kosten“, mahnte die Referentin an. Insgesamt beziffere sich das initiale Investment zur „Digitalisierung“ eines mittelgroßen Labors auf rund fünf Millionen Euro.
Die Qual der Wahl: Produkte überfluten den Markt
Ein weiteres Problem: Momentan schießen Start-ups aus dem Boden, die Produkte für die Pathologie anbieten, viele davon sind redundant. Praktisch jeder hat einen Prostatakarzinom-Detektions-Algorithmus im Portfolio, jeder mit Gleason Grade, jeder hat Ki-67. Die Tools sind teuer, die meisten allerdings nur für Forschungszwecke zugelassen und damit von Erstattungen ausgenommen. Es fehle also der wirtschaftliche Anreiz, sie zu nutzen, erklärte die Referentin. Dazu komme die extreme Dynamik des Marktes. „Wie soll man sich da langfristig auf einen Anbieter festlegen?“
Zeitersparnis durch KI? Aktuell „einfach nicht wahr“
„Tatsächlich gibt es bisher kaum Evidenz dafür, dass KI-Algorithmen in der täglichen Routine Zeit sparen“, betonte Prof. Zlobec. Gebe man einer Pathologin oder einem Pathologen 100 Objektträger ohne oder mit KI, erhöhe das selbstredend die Schnelligkeit bedeutend. Beziehe man aber den Gesamtworkflow mit ein, statt nur einzelner Aufgaben, „ist das momentan einfach nicht wahr“. Eine Ausnahme bilde die Zytopathologie – dort funktioniere KI bei flüssigkeitsbasierter Diagnostik bereits hervorragend.
Um die Arbeitsbelastung der Patholog:innen wirklich zu reduzieren, fehlten derzeit auch noch die passenden Angebote auf dem Markt: Algorithmen zur Quantifizierung von Eosinophilen, Lymphozyten, alles, was mit Zählen zu tun hat, eine Helicobacter-pylori-Erkennung. Stattdessen fokussiert sich die Entwicklung bisher stark auf die Interessen der Onkologie und Aufgaben rund um z. B. die Prognose oder das erwartete Ansprechen.
Gemeinsam ans Ziel
Nicht immer beruht die „Langsamkeit“ also auf einem Widerstand der Patholog:innen, so das Fazit von Prof. Zlobec. Dahinter stecke oft ein begründeter Kampf mit Logistik, Finanzen und auch Verantwortung. Denn mit ihrer Unterschrift unter dem Bericht gewährleisten die Unterzeichnenden dessen Validität, Qualität und Sicherheit. Da sei ein Zögern gegenüber nicht erklärbaren neuen Methoden manchmal angebracht.
Was also hilft, wie kommt man voran? Mit guter Kommunikation zwischen Onkologie und Pathologie, zeigte sich die Referentin überzeugt, und dem Willen, die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Außerdem, ergänzte Prof. Dr. Dr. Julien Calderaro vom Henri Mondor Universitätsklinikum in Crétel, mit nicht-kommerziellen „Homebrew“-KI-Lösungen:2 intern von den eigenen Patholog:innen validiert, wie das auch für andere Diagnostik bereits üblich sei.
Quellen:
1. Zlobec I. ESMO 2025; Vortrag „Current use of AI in pathology“
2. Calderaro J. ESMO 2025; Vortrag „AI in precision oncology of liver cancer“