
Unheimliches Geflecht Klimawandel fördert die Ausbreitung resistenter Pilze
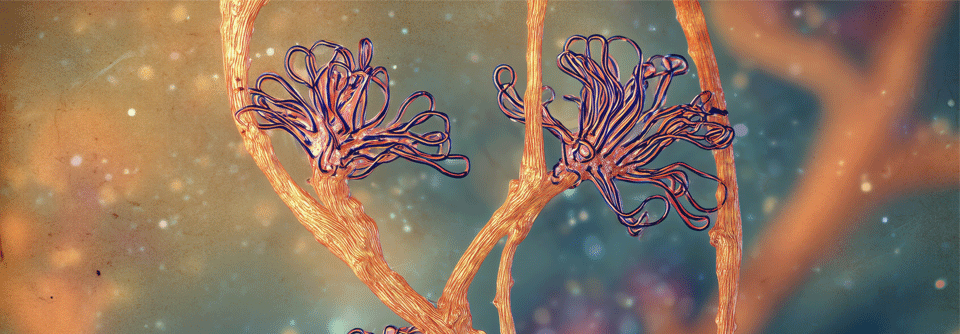 Der Klimawandel fördert die globale Ausbreitung von neuen pathogenen Pilzen
© Dr_Microbe - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Der Klimawandel fördert die globale Ausbreitung von neuen pathogenen Pilzen
© Dr_Microbe - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Der Klimawandel bedroht die Gesundheit nicht nur durch steigende Temperaturen, häufige Extremwetterereignisse und die Zunahme vektorübertragener Erkrankungen, sondern auch durch Pilze. Sie werden immer virulenter und resistenter. Außerdem sind neue pathogene Spezies zu erwarten.
Pilze gehören seit Urzeiten zum globalen Ökosystem, sie sind am Kohlenstoffkreislauf und am Recycling von Nährstoffen beteiligt. Gleichzeitig bedrohen manche Vertreter die Biodiversität, weil sie andere Organismen infizieren können. Beim Menschen verursachen Pilze derzeit mehr als eine Milliarde Hautinfektionen pro Jahr und ca. 2,5 Millionen invasive Infektionen mit Todesfolge, berichtete Prof. Dr. Martin Hönigl von der Klinischen Abteilung für Infektiologie der Medizinischen Universität Graz. Und dabei wird es vermutlich nicht bleiben.
Man geht davon aus, dass sich pathogene Pilze an erhöhte Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster adaptieren. Dies ermöglicht es ihnen, unter vormals ungeeigneten Bedingungen zu wachsen und sich neue Habitate zu erobern, heißt es in einer Studie, an der auch Prof. Hönigl beteiligt war.1 Durch die sich entwickelnde Thermotoleranz werden zudem bislang nicht pathogene Spezies im menschlichen Organismus überlebensfähig. Solche neuen humanpathogenen Spezies gibt es bereits. So wurde z. B. Candida auris 2009 zum ersten Mal als Krankheitserreger beschrieben. Heute ist der Pilz weltweit verbreitet und verursacht jährlich 1,5 Millionen Todesfälle. Cryptococcus deuterogattii hat man 2016 als Verursacher schwerer Infektionen bei zuvor Gesunden identifiziert.
Gesteigerte Mutations- und Resistenzraten
Höhere Temperaturen können zudem die Mutations- und Resistenzraten von Pilzen steigern. Bekannt ist dies von Rhodosporidiobolus fluvialis, der schwer verlaufende Infektionen bei Immungeschwächten auslöst. Bei 37 °C wird der gegen Fluconazol und Caspofungin resistente Keim auch gegenüber Amphotericin B schnell unempfindlich.
Pilze passen sich aber nicht nur an steigende Temperaturen an, sondern auch an intensivere UV-Strahlung, Wasserstress und Nährstoffmangel. Dies gelingt ihnen z. B. über eine vermehrte Produktion bestimmter Enzyme, Veränderungen der Zellwand, erhöhte Melanin- und Biofilmproduktion und bessere Nährstoffnutzung, erläutert das Autorenteam. All dies trage zu einer verstärkten Virulenz bei, was primär für die Landwirtschaft (s. Kasten) Konsequenzen habe.
Mehr Spritzmittel, mehr Resistenzen
Pilze sind auch für Landwirtschaft und Ernährung ein relevantes Thema, da sie Ernteerträge dezimieren (derzeit um bis zu 30 %) und via Mykotoxine die Sicherheit von Lebensmitteln beeinträchtigen. Durch die globale Erwärmung ist mit vermehrtem Pilzbefall und mit neuen pflanzenpathogenen Keimen zu rechnen. Der Verbrauch von Fungiziden wird somit weiter ansteigen, was die Resistenzentwicklung fördert.
Der landwirtschaftliche Einsatz von Fungiziden auf Azolbasis hat vermutlich dazu geführt, dass sich klinisch relevante Keime wie Aspergillus fumigatus als zunehmend resistent gegenüber Azolen erweisen, heißt es in einer Publikation von Dr. Michael Bottery, Universität Manchester, und weiteren Forschenden. Es wurden daher Antimykotika mit einem neuartigen Wirkmechanismus entwickelt. Olorofim und Fosmanogepix werden derzeit in Phase-3-Studien geprüft. Allerdings gibt es bereits zwei Fungizide für die Landwirtschaft, die ihre Effekte über die gleichen Mechanismen entfalten. Eines davon ist bereits zugelassen. Es steht zu befürchten, dass eine breite Anwendung dieser Spritzmittel erneut zur Resistenzentwicklung auch von humanpathogenen Keimen führt.
Nicht zuletzt sorgt der Klimawandel für eine erhöhte Empfindlichkeit des Menschen für Pilzinfektionen. So schwächt die vermehrte Exposition gegenüber UV-Strahlung sowohl die T-Zell-Funktion als auch die Zytokinproduktion und die Komplementaktivierung stark ab. Veränderungen des Hell-Dunkel-Zyklus, der Melatoninproduktion und möglicherweise ein gestörter zirkadianer Rhythmus können ebenfalls zu einer erhöhten Anfälligkeit für Pilzinfektionen beitragen.
Quelle: 1. Sedik S et al. Infect Dis Clin North Am 2025, 39: 1-22; doi: 10.1016/j.idc.2024.11.002
2. Bottery M et al. Thorax 2025; doi: 10.1136/thorax-2024-222168



