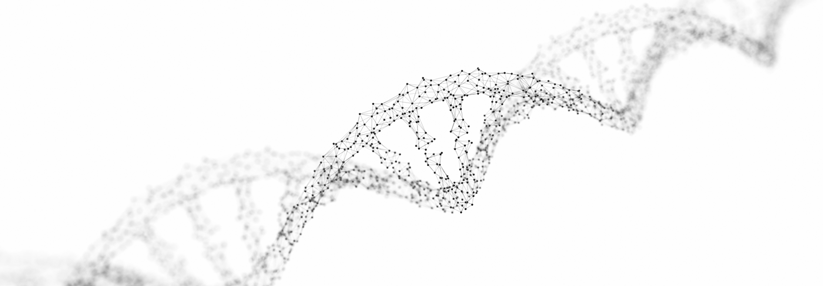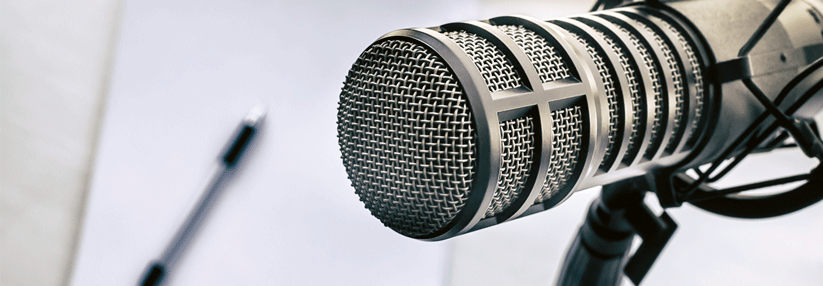Krebs: Auch die Lebensgefährten brauchen Hilfe
 Ängste und Depressionen betreffen nicht nur die Patienten selbst, sondern auch deren Partner.
© fotolia/Photographee.eu
Ängste und Depressionen betreffen nicht nur die Patienten selbst, sondern auch deren Partner.
© fotolia/Photographee.eu
Chronische Erkrankungen werden im sozialen Umfeld erlebt und verarbeitet und der Partner spielt eine zentrale Rolle, indem er emotionale und praktische Hilfe leistet. Dabei lasten Stress, Unsicherheit und Zukunftsängste auf beiden gleichermaßen. Das Wohlbefinden des Partners nimmt erheblichen Einfluss darauf, wie der Patient mit seiner Krankheit zurechtkommt, betonte Professor Dr. Hans-Christoph Friederich von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, LVR-Klinikum Düsseldorf, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Studien haben ergeben, dass Lebensgefährten von Tumorpatienten oft selbst erkranken: Die Prävalenz beispielsweise von Herzerkrankungen, Arthritiden oder Rückenschmerzen ist deutlich höher als im Bevölkerungsdurchschnitt. Zu wissen, welche psychosozialen Risikofaktoren dabei eine Rolle spielen, ist eine wichtige Voraussetzung, um therapeutische Strategien entwickeln zu können. Doch die sind bisher unzureichend untersucht worden.
Es droht Entfremdung statt Rückkehr in die Normalität
Eine Untersuchung, an der 54 Patienten mit Hauttumoren und ihre Partner teilnahmen, zeigt, dass Ängste und Depressionen beide in gleichem Ausmaß betreffen. Dabei scheinen Frauen stärker belastet zu sein als Männer, unabhängig davon, ob sie selbst betroffen sind oder ihr Partner. Wie stark der Lebensgefährte leidet, hängt auch davon ab, wie sehr sich der Erkrankte bei der Bewältigung auf ihn stützt. Die Gefahr besteht, dass sich Paare im Verlauf der Krankheit und der Therapie auseinanderentwickeln, erklärte Professor Dr. Tanja Zimmermann von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie.
Dem Wunsch nach Rückkehr zur Normalität, vor allem nach Abschluss der Behandlung, steht dann womöglich das Bedürfnis entgegen, andere Prioritäten zu setzen. Am Ende kann allen gemeinsamen Bemühungen zum Trotz die Entfremdung stehen, weil sich das Duo und ihre Rollen in der Beziehung auseinanderentwickelt haben.
An der MHH gibt es das Programm „Seite an Seite“, das zunächst für Eltern krebskranker Kinder entwickelt wurde und nun auch für Paare zur Verfügung steht. Darin geht es um Themen wie partnerschaftliche Unterstützung auf emotionaler wie praktischer Ebene, Kommunikation mit Kindern und individuelle wie gemeinsame Copingstrategien.
Über alles reden und Sorgen nicht verheimlichen
Eine wichtige Rolle spielt das „emotionale Updating“ als Grundlage für gemeinsame Stressbewältigung, bei dem sich das Paar über Wünsche, Zukunftspläne, Sorgen und Probleme, aber auch schöne Erlebnisse und Erfolge austauscht. Gefahren lauern im „emotionalen Abpuffern“, also wenn der gesunde Partner seine Gefühle verbirgt, um den Kranken nicht zu belasten.
Die Kollegen in Hannover haben ihr Programm in zwei Studien bei Frauen mit gynäkologischen Tumoren getestet, einmal gegen Psychoedukation kurz nach der Diagnose, einmal gegen progressive Muskelrelaxation nach Abschluss der Krebsbehandlung.
Erstes Ergebnis: Nur schwer lassen sich Paare für eine solche Studie gewinnen. Es erscheint also sinnvoll, eine solche Intervention nicht breit anzubieten, sondern gezielt Betroffene auszuwählen – möglicherweise solche, die durch die Krebserkrankung stark belastet sind oder bei denen es bereits knirscht. Die Studien zeigen ebenfalls, dass die Partnerschaft mehr von Interventionen wie „Seite an Seite“ hat als von Entspannung und Psychoedukation.
Interessant ist eine Beobachtung aus einer kleinen Studie des Projekts „Gemeinsam stark“, über die André Karger, Oberarzt bei Prof. Friederich an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, berichtete. Die eingängige Hypothese, dass Partner mehr von Einzelbetreuung profitieren als von Gruppensitzungen, hat sich nämlich nicht bewahrheitet. Tatsächlich schnitten beide Interventionen gleich gut ab.