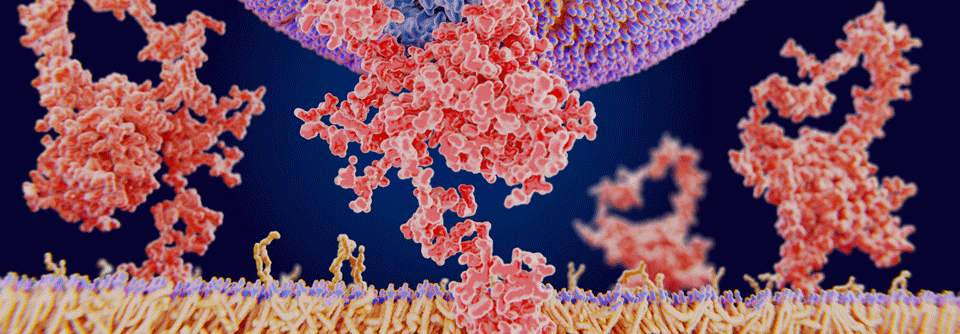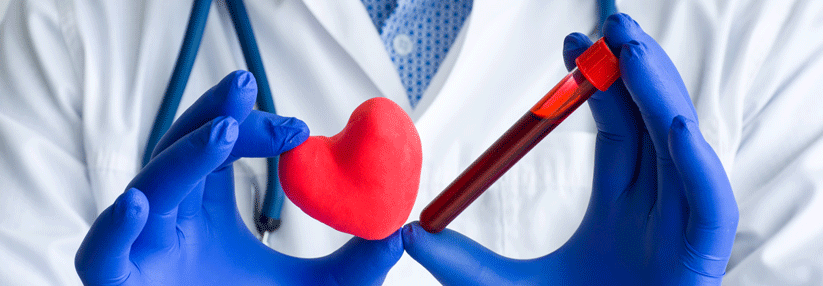
Was tun bei erhöhtem Lipoprotein(a)? Moderne Therapien senken den Spiegel um bis zu 99 %
 Menschen mit hohen Lipoprotein(a)-Werten tragen ein höheres kardiovaskuläres Risiko.
© James Thew - stock.adobe.com
Menschen mit hohen Lipoprotein(a)-Werten tragen ein höheres kardiovaskuläres Risiko.
© James Thew - stock.adobe.com
Lipoprotein(a) ähnelt in seiner Struktur den Low Density Lipoproteinen (LDL) und hat proinflammatorische und proatherogene Eigenschaften. Mehrere Studien konnten belegen, dass Spiegel ab 50 mg/dl mit einem höheren Risiko für arteriosklerotische Erkrankungen wie KHK, PAVK oder Schlaganfall verbunden sind. So zeigten z. B. Daten aus der UK Biobank, dass bei wenigen klassischen Risikofaktoren und einem Lp(a)-Wert von 150 mg/dl das Zehn-Jahresrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen von 5 % auf 14 % steigt. Liegen bereits mehrere konventionelle Gefahren vor, steigert ein Lp(a) von 150 mg/dl das Risiko von 15 % auf 41 %. Bei einem Lp(a) von 50 mg/dl fällt der Risikozuwachs weniger ausgeprägt aus (plus 2 % bei geringem bzw. plus 6 % bei mittlerem konventionellem Risiko).
Normale Lp(a)-Werte bewegen sich zwischen 3 und 29 mg/dl, schreiben Prof. Dr. Samia Mora, Harvard Medical School, und ihr Kollege Prof. Dr. Florian Kronenberg, Universität Innsbruck. Wie hoch die Spiegel ausfallen, ist genetisch bedingt und lässt sich durch Lebensstilinterventionen wie Rauchverzicht, mehr Bewegung und gesunde Ernährung kaum beeinflussen.
Die Fachgesellschaften halten es aber für sinnvoll, an anderen Stellschrauben zu drehen. Die American Heart Association empfiehlt, bei erhöhtem Lp(a) den Beginn einer Statintherapie bzw. eine Dosiserhöhung ins Auge zu fassen. Die europäische Fachgesellschaft hält eine Statintherapie auch für vernünftig, räumt aber ein, dass die Evidenz dafür gering ist. Sowohl die europäische als auch die kanadische Fachgesellschaft empfehlen, das Lp(a) mindestens einmal im Leben zu messen. Ob diese Maßnahme oder eine Pharmakotherapie, die den Spiegel reduziert, einen Nutzen hat, weiß man nicht.
Statine können das Lp(a) allerdings nicht senken, betont das Autorenteam. Bei manchen Menschen steigt es darunter sogar an. Das sollte aber kein Grund sein, eine wegen erhöhter Cholesterinwerte begonnene Statintherapie abzusetzen. PCSK9-Inhibitoren können das LDL-Cholesterin um 50–60 % und das Lp(a) um 15–30 % vermindern, wöchentliche Lipidapheresen reduzieren es um ca. 30–35 %. Möglicherweise kann eine Niedrigdosis-ASS-Therapie das kardiovaskuläre Risiko bei Patientinnen und Patienten mit hohem Lp(a) senken. Neue s. c. mRNA-Therapien, z. B. mit Pelacarsen, Olpasiran, Lepodisiran oder Zerlasiran, oder das p. o. eingenommene Small Molecule Muvalaplin reduzieren den Lp(a)-Spiegel um bis zu 99 %. Zur Frage, ob sich gleichzeitig auch das Herz-Kreislauf-Risiko vermindert, gibt es keine Daten.
Was soll man Betroffenen also empfehlen? Liegt der Lp(a)-Spiegel bei 50 mg/dl oder mehr, sollte man den Patientinnen und Patienten raten, auf das Rauchen zu verzichten, mehr Sport zu treiben, eine mediterrane Diät einzuhalten sowie ggf. den Cholesterinspiegel und den Blutdruck zu senken, schreibt das Autorenduo. Ob man durch die Reduktion des Lp(a) kardiovaskulären Ereignissen vorbeugen kann, ist derzeit nicht bekannt.
Quelle: Mora S, Kronenberg F. JAMA 2025; 333: 1918-1919; doi: 10.1001/jama.2025.2373