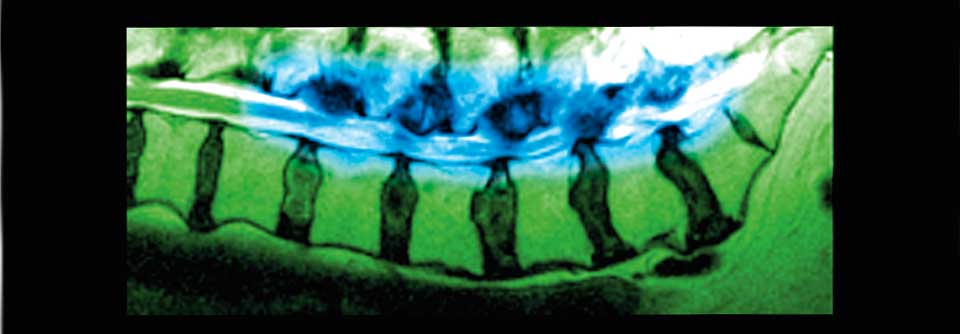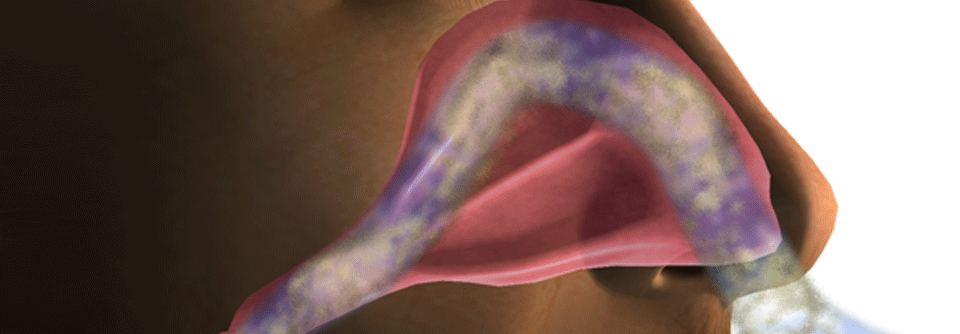Wissenschaft statt Bauchgefühl Mythen über Schmerzmittel im Faktencheck
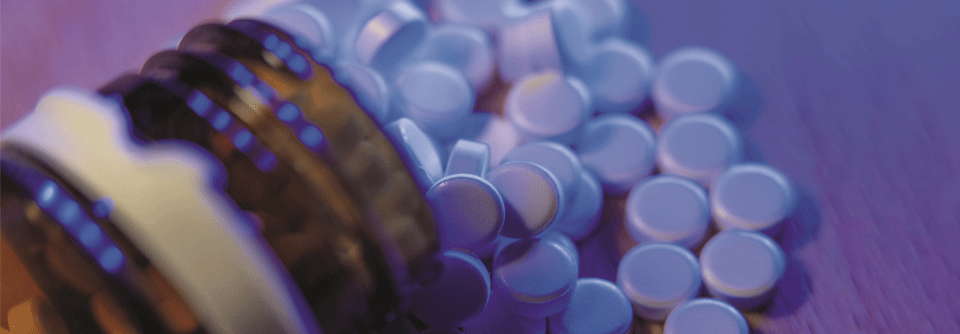 Viele Menschen greifen im Alltag ganz selbstverständlich zu Schmerzmitteln
© monropic - stock.adobe.com
Viele Menschen greifen im Alltag ganz selbstverständlich zu Schmerzmitteln
© monropic - stock.adobe.com
Viele Menschen greifen im Alltag ganz selbstverständlich zu Schmerzmitteln – und fühlen sich dabei sicher, weil die Präparate freiverkäuflich sind. Doch wie so oft ist auch in diesem Fall nicht alles, was ohne Rezept über den Tresen geht, unbedenklich, mahnt PD Dr. Kai-Uwe Kern vom Schmerzzentrum Wiesbaden in der neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Schmerzmittel seien keine homogene Gruppe, sondern „völlig unterschiedliche Substanzen, die man einzeln betrachten muss“. Für die richtige Wahl entscheidend sind unter anderem die Häufigkeit der Anwendung, Dosierung, die Komedikation und vor allem die korrekte Indikation.
Besonders häufig greifen Patientinnen und Patienten zu nichtsteroidalen Antirheumatika wie Ibuprofen, Diclofenac oder ASS. Doch gerade NSAR haben ihre Tücken: „Wir wissen seit Jahren, dass nicht nur Magen-Darm-Beschwerden auftreten können, sondern auch relevante kardiovaskuläre Risiken“, betont Dr. Kern. Die den NSAR ähnlichen Coxibe könnten zwar das Risiko für Magengeschwüre reduzieren, seien aber ebenfalls keine gute Option für eine Dauertherapie. Paracetamol eignet sich gut zur Linderung von akuten Beschwerden wie Kopf- oder Zahnschmerzen, habe aber bei chronischen Rückenschmerzen keinen relevanten Stellenwert. Für entzündliche Krankheitsbilder sei es gänzlich ungeeignet.
Die Zahl der Nebenwirkungen im Verhältnis bewerten
Um kaum ein anderes Schmerzmittel ranken sich in Fachkreisen so viele Debatten wie um Metamizol (Novaminsulfon), weiß Dr. Kern. Seltene, aber schwerwiegende Nebenwirkungen wie Agranulozytose sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Er mahnt jedoch dazu, derartige Ereignisse richtig einzuordnen: „Zwischen 2010 und 2020 wurden in Deutschland jährlich rund 2,7 Millionen Tagesdosen Metamizol eingesetzt. Die Zahl schwerer Nebenwirkungen ist im Verhältnis dazu äußerst gering.“ Ein Vergleich mit Fahrradunfällen mache deutlich, wie verzerrt die menschliche Risikowahrnehmung oftmals sei.
Falle im Patientengespräch das Wort Morphin, bekämen viele erst einmal Angst, erzählt der Schmerzexperte aus Erfahrung. Dafür gibt es seiner Meinung nach zwei Gründe: Zum einen halte sich hartnäckig die Vorstellung, Morphin sei nur etwas für Sterbende. Zum anderen schüren Berichte über die Opioidkrise in den USA die Sorge, dass derartige Schmerzmittel abhängig machen könnten. „Dann frage ich immer zurück: Meinen Sie süchtig oder abhängig? Den Unterschied kennen viele nämlich überhaupt nicht.“ Mit seiner Meinung zur Fentanylkrise in den USA und deren medial bereits heraufbeschworenem Pendant hierzulande hält der Schmerztherapeut nicht hinterm Berg. „Wir haben keine Opiatkrise – und wir werden alles tun, damit es so bleibt.“ Woher er diese Gewissheit nimmt, erläutert er ausführlich im Gespräch mit Medical Tribune.
Auch in Bezug auf das Stufenschema, das die Weltgesundheitsorganisation zum gestaffelten Einsatz von Opioiden verschiedener Klassen empfiehlt, gibt sich Dr. Kern kritisch. Eine starre Reihenfolge helfe wenig, weil die Substanzen unterschiedliche Wirkmechanismen haben. Entscheidend sei, was individuell wirkt und verträglich ist.
Klare Hinweise formuliert der Experte außerdem zur Schmerzmedikation für besondere Personenkreise wie Schwangere, Kinder oder ältere multimorbide Menschen. Auch auf die Themen Alkoholkonsum und Verkehrstüchtigkeit unter Schmerzmitteleinfluss kommt er zu sprechen.
Ein Thema, das bei der Betrachtung von Schmerzmitteln derzeit nicht fehlen darf, ist medizinisches Cannabis. „Die analgetische Wirkung wird überschätzt“, meint Dr. Kern. Nutzen könne man jedoch den psychisch distanzierenden Effekt, den man mit Cannabis unter Umständen erreiche. So verhelfen Öle, Extrakte oder Blüten manchen Patientinnen und Patienten zu einem besseren Schlaf und zu mehr Lebensqualität.
Bei allem dürfe man aber als wichtiges weiteres Standbein der Schmerztherapie die nichtmedikamentösen Ansätze nicht außer Acht lassen, so Dr. Kern. Und er zählt auf: Bewegung, Physiotherapie, psychologische Unterstützung und Ernährungsmaßnahmen. Allerdings müsse man Betroffene dazu oftmals zunächst motivieren. „Wir sind keine Autowerkstatt, die Reifen wechselt. Der Patient muss Eigenverantwortung übernehmen.“ Vielen Schmerzpatientinnen und -patienten falle das Mitmachen nicht leicht.
Ein Lyrikband soll Verständnis für Betroffene schaffen
Um bei Behandelnden und auch Angehörigen mehr Verständnis für den Lebensalltag von Schmerzkranken zu schaffen, hat Dr. Kern gerade einen Gedichtband veröffentlicht: „Heimweh nach Glück – Lyrik für Menschen mit Schmerzen“. Darin verarbeitet er Gefühle, die ihm in seiner Praxis täglich begegnen: von Ohnmacht und Angst bis zu Achtsamkeit und neuer Lebensfreude. „Es ist ein Versuch, Schmerztherapie mit Worten zu betreiben.“
Quelle: Medical-Tribune-Bericht
Mehr zum O-Ton Allgemeinmedizin
O-Ton Allgemeinmedizin gibt es alle 14 Tage donnerstags auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten zum Umgang mit besonders anspruchsvollen Situationen in der Praxis.