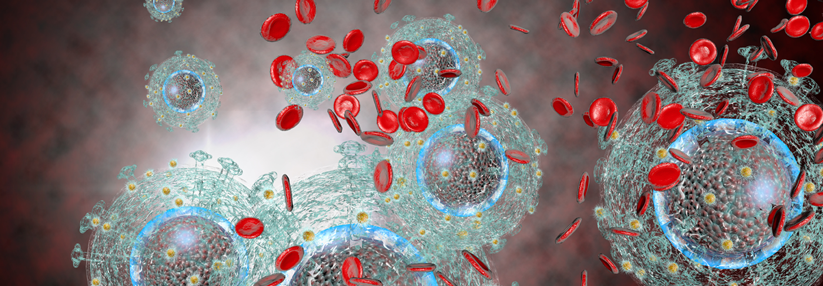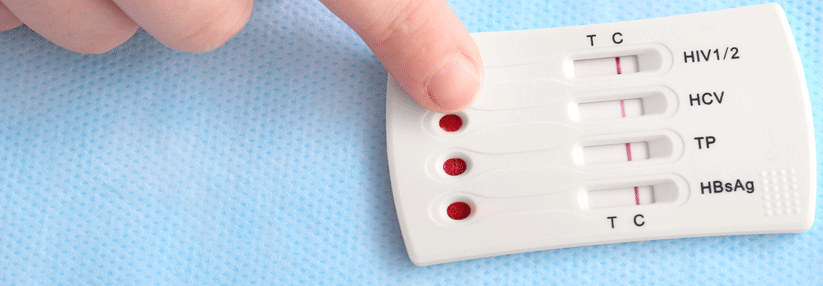
Nicht nur bei Risikogruppen an eine HIV-Infektion denken
 Augen offen halten: Nicht nur die gängigen Risikogruppen können sich mit HIV infizieren.
© Chinnapong, jarun011 – stock.adobe.com
Augen offen halten: Nicht nur die gängigen Risikogruppen können sich mit HIV infizieren.
© Chinnapong, jarun011 – stock.adobe.com
Einen HIV-Test ordnen Sie nicht mal so nebenbei nur der Vollständigkeit halber an. Wann aber sollten Sie es sinnvollerweise tun? Natürlich kann ein möglicherweise Betroffener kommen und sagen: „Herr Doktor, könnten Sie nicht mal … ich hab da so einen Test gemacht“.
Test im Do-it-yourself-Verfahren?
Seit 2018 sind in Deutschland HIV-Selbsttests zugelassen und in Apotheken, Drogerien und im Internet erhältlich. Den Test kann der Patient zu Hause mit einem Tropfen Fingerblut durchführen und nach rund 15 min das Ergebnis ablesen.
Einerseits lassen sich durch dieses Angebot Menschen erreichen, die sich sonst schämen, mit ihrem Verdacht auf eine Infektion zum Arzt zu gehen. Andererseits muss sich der Betroffene, wenn der Test positiv ausfällt, auf jeden Fall untersuchen lassen, um den Befund zu überprüfen. Und ein negativer Test schließt HIV nicht 100%ig aus: Das Verfahren weist lediglich Anti-HIV-Antikörper nach und reagiert damit erst ca. drei Monate nach einer Ansteckung positiv.
Das ist aber vermutlich eher die Ausnahme: Immer noch fürchten Patienten, dass ihr Arzt bei einem HIV-Nachweis ihren Lebensstil – und damit sie selbst – verurteilt, erklären Juliane Ankert vom Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena und ihre Kollegen.
Untersuchung belastet das Laborbudget nicht
Oft haben aber auch Mediziner die Erkrankung nicht ausreichend auf dem Schirm. An eine HIV-Infektion denkt man vielleicht noch beim „Klischee-Patienten“: junger Mann mit homosexuellen Kontakten und/oder intravenösem Drogenmissbrauch, der eventuell aus einem Endemiegebiet stammt und sich gar noch prostituiert. Einerseits aber sieht man diese Risikofaktoren nicht jedem unbedingt an und andererseits führt diese Vorstellung oft in die Irre. Beispielsweise kann die monogam lebende Hausfrau von ihrem Partner, der ohne ihr Wissen häufige sexuelle Kontakte mit wechselnden Männern hat, infiziert worden sein. Denken Sie also genauso an eine HIV-Infektion, wenn Ihr Patient:- eine AIDS definierende Erkrankung hat, wie häufige Lungenentzündungen (mehr als zwei pro Jahr), ein Zervixkarzinom oder ein Non-Hodgkin-Lymphom,
- einen Indikator aufweist – also etwas, das häufig mit HIV vergesellschaft ist, z.B. Fieber, für das Sie keinen eindeutigen Grund finden, andere sexuell übertragbare Erkrankungen wie Hepatitis B oder C, einen Zoster oder unerklärliche Befunde im Blutbild (Leukopenie/Thrombozytopenie) sowie
- an einer Erkrankung leidet, die mit einer höheren HIV-Prävalenz einhergeht, z.B. Lymphadenopathie, periphere Neuropathie, Psoriasis.
Den Befund immer mit zweiter Blutabnahme bestätigen
Sobald Sie über die Diagnose Bescheid wissen, informieren Sie den Patienten darüber – im persönlichen Gespräch, nicht telefonisch und nicht brieflich. Um falsche Ergebnisse wegen einer Probenverwechslung zu vermeiden, müssen Sie dem Betroffenen außerdem ein zweites Mal Blut abnehmen und ins Labor zur Bestätigung schicken. Sie sollten aber schon jetzt mit einer HIV-Schwerpunktpraxis Kontakt aufnehmen, an die Sie den Betroffenen überweisen. Der dortige Spezialist veranlasst dann weitere Untersuchungen, z.B. die Bestimmung der einzelnen Lymphozytenuntergruppen, und wird die Behandlung gemeinsam mit dem Patienten besprechen.Quelle: Ankert J et al. Dtsch Med Wochenschr 2019; 144: 1158-1165; DOI: 10.1055/a-0813-3850