
Gefährliche Nebenwirkung verhindern Opioidinduzierte Obstipation richtig und sicher behandeln
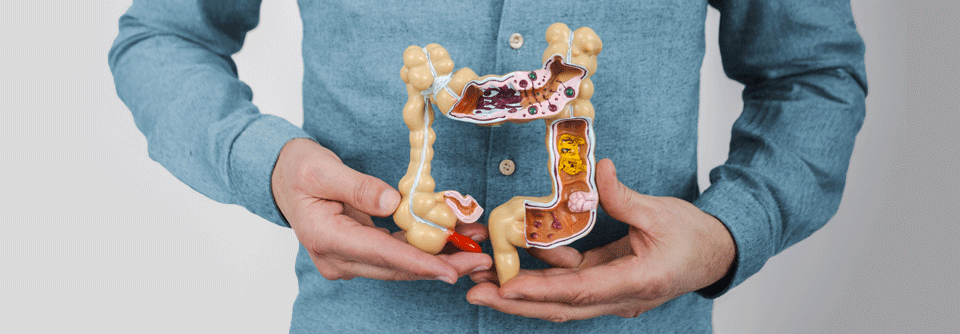 Zu den häufigen unerwünschten Wirkungen von Opioiden gehört die Obstipation.
© Peakstock - stock.adobe.com
Zu den häufigen unerwünschten Wirkungen von Opioiden gehört die Obstipation.
© Peakstock - stock.adobe.com
Zu den häufigen unerwünschten Wirkungen von Opioiden gehört die Obstipation. Wie kann sie sicher behandelt und lebensbedrohliche Komplikationen wie Darmperforationen vermieden werden?
Opioide gehören bei Tumorpatientinnen und -patienten immer noch zu den am häufigsten verschriebenen Arzneimitteln, sie können aber zu einer – manchmal chronischen – Obstipation führen. Um die besten Strategien für das Management der opioidinduzierten Obstipation (OIC) zusammenzutragen, hat das Team um Dr. Neel Mehta vom Weill Cornell Medical College in New York eine systematische Literaturrecherche hinsichtlich unerwünschter Medikamentenwirkungen durchgeführt.
In der Allgemeinbevölkerung tritt eine Obstipation aufgrund einer Opioidtherapie in 2–3 % der Fälle auf, bei in der Klinik Behandelten liegen die Werte allerdings wesentlich höher. Hier ergaben die Originalarbeiten für Krebspatientinnen und -patienten Raten zwischen 51 und 87 %. Bei sonstigen chronischen Schmerzkrankheiten, die mit einem Opioid behandelt wurden, waren zwischen 41 und 57 % der Behandelten betroffen.
Von den im gesamten Magen-Darm-Trakt befindlichen Opioidrezeptoren stellen die insbesondere im Dünndarm und im proximalen Kolon sitzenden µ-Rezeptoren die wichtigsten Mediatoren der opioidinduzierten Analgesie dar. Im Darm beeinflussen sie auch Motilität und Sekretion und können dadurch eine Obstipation auslösen. Selten, dann aber potenziell lebensbedrohlich, birgt eine solche Verstopfung die Gefahr einer gastrointestinalen Perforation.
μ-Opioidrezeptorantagonisten erhöhen Perforationsgefahr
Häufig wird zur Behandlung der Obstipation zunächst ein nicht rezeptpflichtiges Laxans empfohlen, beispielsweise Bisacodyl. Reicht dies nicht aus, können peripher wirkende µ-Opioidrezeptorantagonisten (PAMORA) wie Methylnaltrexon, Naldemedin oder Naloxegol eingesetzt werden. Beide Substanzklassen erhöhen allerdings das Risiko einer Darmperforation. Grund hierfür ist vermutlich eine zusätzliche Schwächung der bereits geschädigten Darmschleimhaut. Verbleibt durch die chronische Obstipation Kotmasse im Darm, kann das zu Entzündungen, Ischämie und im schlimmsten Fall zu einem Kolonriss führen.
Auch Antitumormedikamente (z. B. Bevacizumab, Sorafenib) können über verschiedene Mechanismen die Kontinuität des Magen-Darm-Trakts durch eine Perforation unterbrechen. Einige Antirheumatika haben diesen Effekt ebenfalls gezeigt, das größte Risiko scheinen Tocilizumab und Tofacitinib aufzuweisen. Bei all diesen Faktoren sind PAMORA kontraindiziert.
Die Anamnese bei opioidinduzierter Obstipation beinhaltet neben der Frage nach den üblichen Stuhlgewohnheiten auch die nach Begleiterkrankungen, die die Durchlässigkeit der Darmwand fördern und zu einer Perforation führen könnten. Dazu zählen peptische Ulkuskrankheit, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen oder Divertikulitis. Vorangegangene chirurgische Eingriffe oder Endoskopien erhöhen das Risiko für eine Perforation ebenfalls.
Eine Darmobstruktion als möglicher Vorbote kündigt sich mit Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen an, bei der Untersuchung fallen ein hochgewölbtes, gespanntes Abdomen und fehlende Darmgeräusche auf. Um eine Perforation zu vemeiden, ist bei Verdacht umgehend ein OP-Team hinzuzuziehen. Wenn machbar, sollten möglicherweise verantwortliche Medikamente abgesetzt werden.
Quelle: Mehta N et al. J Clin Gastroenterol 2025, 591: 491-496; doi: 10.1097/MCG.00000000000002185
