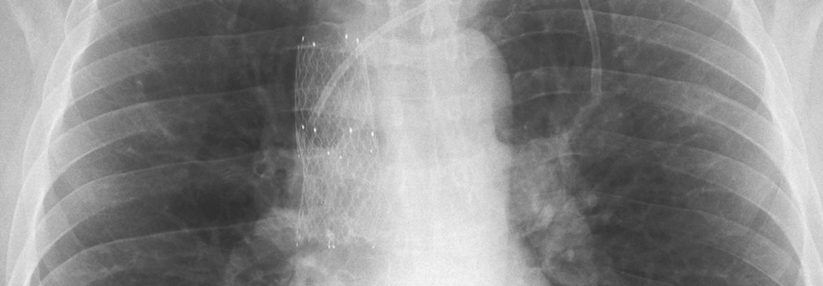Palliativversorgung und Sterbebegleitung: „Bewohnern ein wirkliches Zuhause sein“
 Wie kann der Thanatologie – kurzgefasst Pflegeort möglichst häuslich wahrgenommen werden? Rechts: Prof. Dr. Wolfgang George, Wissenschaftlicher Leiter des TransMIT-Projektbereichs für Versorgungsforschung und Beratung.
© iStock/LPETTET & Prof. Dr. W. George
Wie kann der Thanatologie – kurzgefasst Pflegeort möglichst häuslich wahrgenommen werden? Rechts: Prof. Dr. Wolfgang George, Wissenschaftlicher Leiter des TransMIT-Projektbereichs für Versorgungsforschung und Beratung.
© iStock/LPETTET & Prof. Dr. W. George
Viele Menschen verbringen ihre letzte Lebensphase in Pflegeheimen. Wie schätzen Sie die Pflegesituation und Sterbebegleitung dort ein?
Prof. George: Die Bedingungen in den über 13 000 stationären Pflegeeinrichtungen, in denen zwischen 250 000 und 300 000 Menschen und damit etwas weniger als ein Drittel aller Bundesbürger jährlich sterben, müssen zusammengefasst als schwierig bewertet werden. Zugleich konnten wir in unseren Studien aufzeigen, dass in diesem großen Pool sehr unterschiedliche Versorgungsqualitäten erreicht werden.
So gibt es eine ganze Gruppe von Einrichtungen, denen wir unsere alten Menschen durchaus auch zum Sterben anvertrauen können. Aber leider auch eine erhebliche Anzahl, bei denen wir in Sorge sein müssen.
Und Letzteres bedeutet?
Prof. George: Bei etwa einem Drittel der Pflegeeinrichtungen bestehen unterschiedlichste Problemlagen – was auch empirisch belegt ist. Dies betrifft insbesondere große Einrichtungen. Wobei die Bedingungen im städtischen Raum schwieriger zu sein scheinen als in ländlichen Regionen. Auf Basis unserer Erhebungen müssen wir davon ausgehen, dass die Situation in Pflegeheimen privater Trägerschaft am problematischsten ist.
Liegt dies auch am ökonomischen Druck, an der Arbeitstaktung?
Prof. George: Zweifelsohne stellt sich immer die gleiche Frage: Wo gehen die erreichten ökonomischen Mehrwerte und Einnahmen hin? Wir haben aufzeigen können, dass sich die Betreuung von Sterbenden in vergleichbaren Einrichtungen stark unterscheidet und die erzielten Einnahmen offensichtlich in unterschiedlichem Maß in die Versorgung investiert werden.
Inwieweit unterscheiden sich die Versorgungssituationen in Hospizen und Pflegeheimen?
Prof. George: Allein von der Finanzierung sind diese Orte fast nicht vergleichbar, wenngleich beides Einrichtungen der stationären Pflege sind. Erhält ein Hospiz für die Betreuung eines Sterbenden nach SGB V circa 8300 Euro pro Monat, so erhält eine Pflegeeinrichtung nach SGB XI bei Pflegegrad 5 monatlich 2005 Euro – also weniger als ein Viertel. Sie sind aber auch von deren epidemiologischer Evidenz als Sterbeort nicht wirklich vergleichbar. In Hospizen versterben jährlich weniger als 20 000 Menschen, in Pflegeeinrichtungen sind es größenordnungsmäßig 15-mal mehr. Zugleich konnten wir in unseren empirischen Studien zeigen, dass die Versorgungsqualität in den Hospizen deutlich besser ist als in einer normalen stationären Pflegeeinrichtung. Das war natürlich nicht überraschend.
Können Sie dies verdeutlichen?
Prof. George: Wir haben im Rahmen unserer Studien unterschiedlichste Versorgungsaspekte erhoben. So fragten wir beispielsweise, wie die Angehörigenintegration gelingt. Oder: Wie gelingt die Symptomkontrolle? Inwieweit werden die Bewohner planerisch aktiv in das Geschehen einbezogen? Gibt es Seelsorger und in welchem Ausmaß bemühen sich diese um die Sterbenden? Im Hinblick auf all unsere abgefragten Studienaspekte liegen die Hospize in der erreichten Ergebnisqualität vor den Pflegeeinrichtungen und auch vor den Krankenhäusern – zum Teil deutlich, zum Teil nicht so deutlich. Auch z.B. bei der Frage „Wie viel Zeit können Sie sich für die Betreuung Sterbender nehmen?“ schnitten Hospize deutlich besser ab.
Was muss in Pflegeheimen hinsichtlich der Palliativversorgung und Sterbebegleitung schnellstmöglich verbessert werden?
Prof. George: Es ist klar, dass die Mittelausstattung nicht hinreichend ist. Diese Unter- bzw. Fehlfinanzierung zeigt sich natürlich insbesondere in der Personalbesetzung und auch der Personalqualität. Hier müssen die ersten und zentralen Verbesserungen erreicht werden. Zugleich hatten wir ja aufzeigen können, dass unter sehr wohl vergleichbaren Bedingungen unterschiedliche Qualitäten erreicht werden können. Geld ist also notwendig, aber allein nicht in jedem Fall hinreichend. Die Versorgungsqualität hat auch mit den Werten und Zielen der Einrichtung zu tun – und damit auch mit den Werten der Mitarbeiter. Letztlich stellt sich doch die Frage, ob es einer Einrichtung gelingt, den Bewohnern ein wirkliches „Zuhause“ zu sein. Genau genommen sollte sich dies als dezidierte Unternehmensphilosophie dann auch im Kopf der Mitarbeiter abspielen.
Das bedeutet, dass mittelfristig auch eine Werte-Diskussion anzustoßen ist?
Prof. George: Ja, es geht mittelfristig für die Pflegeheime um die Etablierung einer Kultur des „Zu-Hause-Seins“ des Bewohners. In diesem Zuhause wird dann auch eine würdevolle Praxis des Sterbens zu organisieren sein. Dabei geht es keinesfalls nur um eine gelungene Betreuung Sterbender, sondern um eine menschengerechte Versorgung insgesamt – also um eine prinzipielle Art des Patienten- bzw. Bewohnerverständnisses. Wenn wir dies nicht generell in der Gesellschaft und den Pflegeheimen kultivieren, wie soll das dann plötzlich im Umgang mit Sterbenden da sein. Dieses „Umschalten“ muss durch das Management der Einrichtung getragen und auch politisch verantwortet sein.
In diesem Zusammenhang bedauere ich sehr, dass es seit Jahrzehnten sehr ausdifferenzierte psychoonkologische Modelle und Praktiken gibt, die in der heutigen Onkologie leider nur einen geringen Raum zu besitzen scheinen. Gerade die (Psycho-) Onkologie weiß doch in hervorragendem Maß mit dem Thema Sterben verantwortlich umzugehen – im Sinne einer Palliativkultur.
Welches Versorgungskonzept haben Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen vor Augen?
Prof. George: Eigentlich spreche ich mich schon immer für ein „Inklusionsmodell“ der Schwerstkranken und Sterbenden aus. Das heißt, sterbende Menschen werden dort betreut, wo sie aufgrund ihrer biografischen Lebenslage und ihres Lebensalters – durchaus auch ihrer Krankengeschichte – angekommen sind. Dies heißt, dass sie möglichst wohnortnah, am besten noch zu Hause unter möglichst „Teilhabe ermöglichenden Bedingungen“ versterben können, also in einem weitgehend normalen sozialen Kontext.
Bezüglich des Sterbeortes sollten wir immer vor Augen haben, dass die Menschen am liebsten zu Hause sterben wollen. Also stellt sich zugespitzt die Frage, wie man es bestmöglich hinbekommt, dass auch eine Pflegeeinrichtung oder eine Krankenhausstation möglichst häuslich wahrgenommen wird.
Was ist in Planung?
Prof. George: Wir führen jetzt eine weitere Studie zur Versorgung Sterbender durch, um die Situation noch besser einschätzen zu können und die Bedingungen für Sterbende weiter zu verbessern. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass etwa 80 % der sterbenden Menschen ihre letzten Lebenstage in stationären Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Hospizen verbringen und ein nicht unerheblicher Anteil dieser Krankenhauspatienten und Heimbewohner nochmals in ihrer letzten Lebensphase in andere Institutionen oder innerhalb der eigenen Einrichtung verlegt wird.
Daraus ergibt sich eine Vielzahl von Fragen z.B.: Werden Sterbende auf Stationen mit erhöhter medizinischer Performance aufgrund scheinbarer Notfälle verlegt? Oder: Werden Sterbende zu lange onkologisch oder intensivmedizinisch behandelt, obwohl nach realistischer Einschätzung ausschließlich eine palliative Behandlung sinnvoll wäre?
Und Ihre ganz persönliche Einschätzung?
Prof. George: Ganz sicher sind einige weitere Klärungen notwendig. Nicht nur die Pflegeheime bedürfen der Aufmerksamkeit. Auch der bedeutsame Sterbeort Intensivstation müsste genauer beschrieben werden, nicht nur wegen seiner hohen ökonomischen, sondern auch wegen der sozialen Kosten, etwa aufseiten der Mitarbeiter. So bleibt generell einiges zu tun und zugleich sehe ich auch einen zunehmend breiteren gesellschaftspolitischen Gestaltungswillen. Wir leben in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Ein sehr gelungenes Dokument, mit welchen Konsequenzen dies einhergeht, ist übrigens der siebte Altenbericht der Bundesregierung*, den ich jedem als einen Orientierungspunkt empfehlen kann, der sich für sterbende Menschen einsetzt.
* www.siebter-altenbericht.de