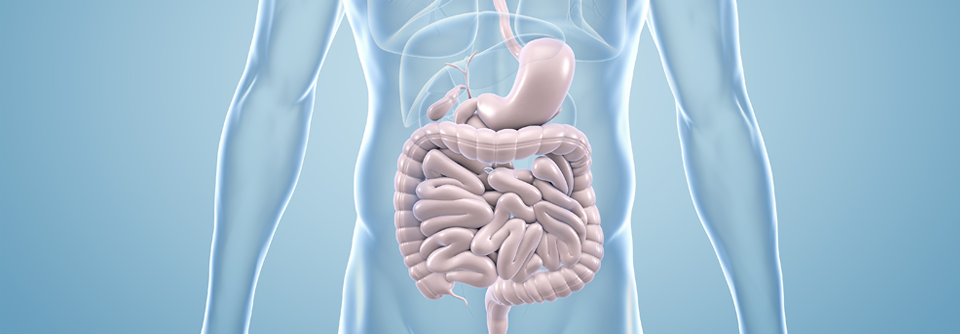
Magenschutz als stiller Blutdrucktreiber PPI erhöhen postmenopausale Hypertonierate
 Protonenpumpenhemmer (PPI) sind die bevorzugte Therapie bei Ösophagitis und peptischem Ulkus.
© lordn - stock.adobe.com
Protonenpumpenhemmer (PPI) sind die bevorzugte Therapie bei Ösophagitis und peptischem Ulkus.
© lordn - stock.adobe.com
Eine Beobachtungsstudie aus den USA mit 64.720 postmenopausalen Frauen ohne kardiovaskuläre Vorerkrankungen zeigt jedoch: Die Einnahme von PPI ist mit einem erhöhten Risiko für neu auftretende arterielle Hypertonie assoziiert.
Über einen Zeitraum von im Schnitt 8,7 Jahren wurden Hypertonien anhand von Selbstauskünften dokumentiert. Knapp 29.000 Teilnehmerinnen entwickelten im Verlauf eine Hypertonie. Frauen, die PPI einnahmen, hatten ein um 17 % erhöhtes Risiko im Vergleich zu jenen ohne diese Therapie (Hazard Ratio, HR, 1,17). Besonders fiel auf, dass mit zunehmender Einnahmedauer das Risiko stieg: Unter einem Jahr betrug die HR 1,13, nach ein bis drei Jahren 1,17 und bei über drei Jahren 1,28. Zudem zeigten Frauen mit PPI-Neueinstellung innerhalb von drei Jahren einen signifikanten Anstieg des systolischen Blutdrucks um durchschnittlich 3,4 mmHg im Vergleich zu Frauen, die nie PPI einnahmen.
Das Autorenteam vermutet als möglichen Mechanismus eine gestörte Umwandlung von Nitrit zu gefäßerweiterndem Stickstoffmonoxid. Hierfür braucht es nämlich Magensäure, die durch PPI gehemmt wird. Eine langfristige PPI-Einnahme könnte also mehr als nur den Magen beeinflussen. Auch wenn ein kausaler Zusammenhang noch nicht bewiesen ist, sollte bei Dauertherapie eine Risiko-Nutzen-Abwägung erfolgen – insbesondere bei Patientinnen mit kardiovaskulären Risikofaktoren.
Quelle: Soliman AI et al. J Am Heart Assoc. 2025; 14: e040009; doi: 10.1161/JAHA.124.040009


