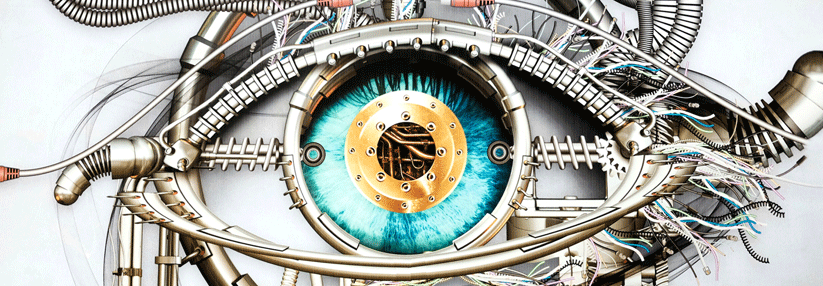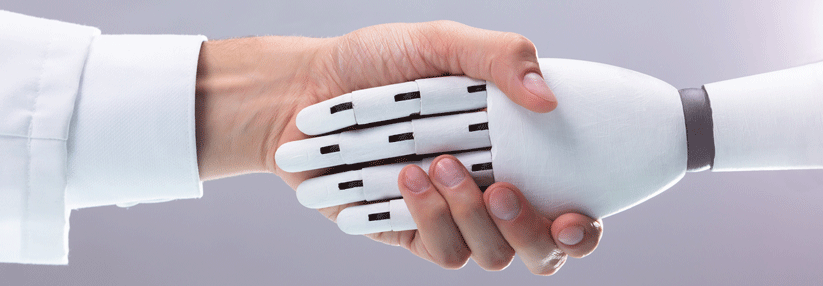Ein Interview Prof. Dr. Stefanie Speidel forscht an KI-Unterstützung für Chirurg:innen
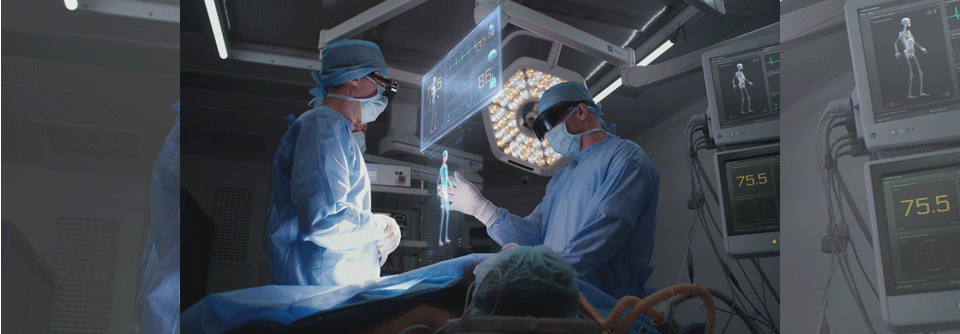 Algorithmen könnten Chirurg:innen entlasten – bei steigender Alterung, Personalmangel und komplexen Operationsanforderungen.
© Framestock – stock.adobe.com
Algorithmen könnten Chirurg:innen entlasten – bei steigender Alterung, Personalmangel und komplexen Operationsanforderungen.
© Framestock – stock.adobe.com
Warum braucht es weiteren technischen Fortschritt in der Chirurgie?
Prof. Dr. Stefanie Speidel: Zum einen haben wir einen extremen Personalmangel, der sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren in der alternden Bevölkerung weiter verschärfen wird. Zum anderen sind postoperative Komplikationen die dritthäufigste Todesursache weltweit. Demzufolge brauchen wir Assistenzsysteme, die Operationen akkurater machen sowie solche, die diesen Personalmangel ausgleichen.
In welchen Bereichen unterstützen KI-Anwendungen künftig Chirurg:innen?
Prof. Speidel: Entlang der Behandlungskette lässt sich an allen Stellen KI einsetzen. Das beginnt präoperativ, betrifft aber auch intraoperative und postoperative Unterstützung.
Wie kann das konkret in der Praxis aussehen?
Prof. Speidel: Vor der Operation könnte ein Algorithmus beispielsweise anhand von Informationen wie Bilddaten, Laborwerten oder der medizinischen Historie Risikoscores für intraoperative Komplikationen errechnen. Darüber hinaus könnte er Therapieempfehlungen geben, das heißt, raten, welche Operationsstrategie sich für wen am besten eignet.
Während des Eingriffs besteht eine mögliche Assistenzfunktion darin, wie bei einem Navigationssystem Ziel- und Risikostrukturen anzuzeigen. Wo befindet sich der Tumor und wo befindet sich Gewebe, das nicht verletzt werden darf? Auch intraoperativ kann zudem eine Risikobewertung erfolgen. Zusätzlich kommt bei robotergestützten OPs die Automatisierung einzelner Schritte infrage, zum Beispiel selbstständiges Knoten oder eine KI-gestützte Kameraführung. Wenn Erkrankte dann postoperativ auf der Intensivstation liegen, lassen sich auf Basis dort erhobener Daten Risiken für Komplikationen vorhersagen.
Können KI-Anwendungen dazu beitragen, den Qualitätsunterschied zwischen kleinen und großen Zentren zu verringern?
Prof. Speidel: Ja, indem sie Komplikationen reduzieren, die im Vergleich zu kleinen Häusern dort seltener auftreten, wo das medizinische Personal Eingriffe häufiger durchführt. Dadurch, dass man das Wissen von Expert:innen quantifiziert und auf eine Maschine überträgt, streben Forschende auch eine Demokratisierung dieses Wissens an.
Wie steht es um weitere Vorteile der neuen Technologien?
Prof. Speidel: Da gibt es verschiedene Baustellen: Wir wollen den Personalmangel adressieren, Komplikationen verringern, aber auch die Patient:innen berücksichtigen. Der Mangel an Expert:innen ist ein erhebliches Problem der Zukunft. Ich sehe große Vorteile darin, wenn man Remote-Expertise hinzuschalten kann, beispielsweise beim Telementoring in kritischen Phasen während der Operation erfahrene Fachleute befragen kann.
Wo liegen die größten Herausforderungen in der Entwicklung und Validierung solcher Systeme?
Prof. Speidel: Deep Learning benötigt viele Daten, die gerade im Bereich der Chirurgie rar sind. Dazu müssen Eingriffe per Video aufgezeichnet werden, was nicht standardmäßig überall geschieht. Im Anschluss brauchen Sie Expert:innen, die die Daten für das Training annotieren, also in den Aufnahmen markieren, wo zum Beispiel eine Komplikation auftritt oder geschnitten werden muss. Hinzu kommt, dass wir sehr heterogene Datenquellen haben, neben Videos unter anderem auch Gelenkstellungen von Robotern.
Regulatorische Anforderungen spielen auch eine große Rolle, etwa an die Erklärbarkeit. Diese KI-Systeme dürfen nicht in der Forschung oder ein theoretisches Konzept bleiben. Wir müssen klinische Studien durchführen, um zu zeigen, dass sie wirklich eine Verbesserung bieten.
In Europa ist es relativ schwierig, solche Studien als Forschungseinrichtung auf den Weg zu bringen. Die Gesetzeslage für Medizinprodukte hat sich in den letzten Jahren durch die Einführung der EU-Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) erheblich geändert. Dadurch sind die Anforderungen an klinische Prüfungen zur Produktbewertung enorm gestiegen.
Welche KI-Anwendungen befinden sich bereits in fortgeschrittenen Entwicklungsstadien?
Prof. Speidel: Wir haben noch keine KI im OP und auch keine zugelassenen Produkte oder randomisierte, kontrollierte Studien. Bei der Darmspiegelung gibt es zertifizierte Systeme, die automatisch Polypen detektieren, aber das hat letztendlich nichts mit Chirurgie zu tun.
Unser Team hat die CoBot-Studie auf den Weg gebracht, in der es darum geht, ein KI-System für Rektumresektionen zu validieren. Eine erste Pilotuntersuchung läuft bereits. Der Algorithmus soll während der Operation Entscheidungsunterstützung bieten und zeigt Ziel- und Risikostrukturen an. Er läuft aber während der Erprobung nicht über das System des OP-Roboters, sondern über einen separaten Bildschirm.
Wie lange dauert es noch, bis Chirurg:innen KI routinemäßig nutzen werden?
Prof. Speidel: Das hängt meiner Ansicht nach davon ab, an welchem Punkt im Behandlungspfad Ärzt:innen die KI einsetzen. Ich glaube, dass man präoperativ schon relativ zeitnah Systeme haben wird. Intraoperativ sind wir davon noch weiter entfernt, was auch mit der Risikoklassifikation der Anwendungen in Verbindung steht.
Wie wird sich das Berufsbild „Chirurg:in“ in zehn Jahren verändert haben?
Prof. Speidel: Ich denke nicht, dass der Chirurg oder die Chirurgin ersetzt wird. Stattdessen zählt, eine optimale Mensch-Maschine-Kooperation zu ermöglichen. Das braucht eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen. Zusammenfassend scheint mir ein gewisses KI-Grundverständnis zentral, aber dafür muss man nicht programmieren können.
Quelle.
Interview: Lara Sommer