
Depression und Dialyse Psychische Komorbiditäten und die Notwendigkeit einer psychonephrologischen Begleitung
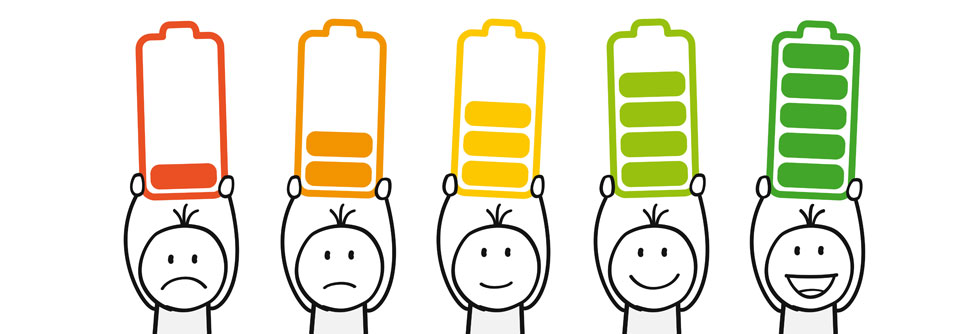 Patient:innen in ihrem „Kosmos“ sehen: Sie verfügen über ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ihre „Batterien“ wieder aufzuladen.
© rosifan19 - stock.adobe.com
Patient:innen in ihrem „Kosmos“ sehen: Sie verfügen über ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ihre „Batterien“ wieder aufzuladen.
© rosifan19 - stock.adobe.com
Die Diagnose einer chronischen Nierenerkrankung respektive die Mitteilung mit einer Nierenersatztherapie beginnen zu müssen, ist für Betroffene eine enorme Veränderung, die sich auch stark auf die psychische Verfassung der Patienten und Patientinnen auswirken kann. Es können Stimmungsschwankungen, Niedergeschlagenheit, Wut und Resignation auftreten, bis hin zur Entwicklung von verschiedenen Formen einer Depression. Aber auch bei Menschen, die bereits vor der CKD-Diagnose Depressionen hatten, ist dies als Komorbidität zu berücksichtigen. Frau Dr. Angenendt erläutert, welche Einflussfaktoren eine Rolle spielen und worauf aus psychosozialer Sicht bei Dialysepflichtigkeit zu achten ist.
Bei Dialysepatienten und -patientinnen gilt eine Depression als das häufigste psychische Problem. Man geht von einer durchschnittlichen Häufigkeit von ca. 20 bis 30 % aus, wobei die Zahlen variieren, weil die Prävalenz schwer zu bestimmen ist. Woran liegt das, werden Depressionen im Routinebetrieb einer Dialysepraxis zu häufig nicht erkannt? Gibt es keine psychonephrologische Betreuung wie beispielsweise in der Onkologie?
Dr. Gabriele Angenendt: Zum einen können die Symptome einer Depression wie zum Beispiel Erschöpfung, Appetitlosigkeit oder Schlafprobleme oft mit typischen Nebenwirkungen der Dialyse selbst verwechselt werden. Zum anderen ist es auch sicher so, dass das Fachpersonal in den Dialysepraxen keine ausreichende Erfahrung im Bereich der psychischen Erkrankung aufweisen kann. Es ist in der Routine der Praxis überdies einfach nicht genug Zeit, um psychische Symptome von nicht geschulten Personen zu bewerten und gegebenenfalls einer Behandlung zuzuführen. Es ist zudem auch eine Frage der Persönlichkeit der Patientin/des Patienten, wie viel sie ihre Ärztin oder ihren Arzt wissen lassen, oder auch nicht. Außerdem kommt es auf das Alter und das Geschlecht an: Die meisten Dialysepatient:innen gehören heute noch einer Generation an, die sich nicht traut, über psychische Beschwerden zu sprechen, vor allem Männer haben Angst vor Stigmatisierung, sie behalten ihre Beschwerden lieber für sich. Viele wollen „ein pflegeleichter Patient“ sein, wünschen sich nur, dass die Ärztin/der Arzt ihnen hilft, mit der Nierenersatztherapie am Leben zu bleiben. Alles andere wird verdrängt.
Jüngere Menschen, und in dieser Klientel wiederum mehr Frauen als Männer, sind bezüglich psychischer Begleiterkrankungen inzwischen offener. Sie sagen häufiger o.k., ich glaub, ich hab ein Problem, da muss ich ran, ich spreche mit einer Vertrauensperson darüber und suche mir Hilfe, um meine Lebensqualität zu erhalten. In der Regel hängt es aber immer von dem Grad des Vertrauens ab, das die Patientin oder der Patient bereit ist, dem Pflegeteam bzw. der Ärztin/dem Arzt entgegen zu bringen. Und das hängt wiederum davon ab, inwieweit das Pflegeteam und auch die Ärztin und der Arzt bereit sind, die Kommunikation mit der Patientin oder dem Patienten zu suchen und so zu „personalisieren“, dass sie oder er sich gemeint fühlt. Es ist ein Unterschied, ob jemand in einer großen Institution sagt: „Wir sorgen für Ihre Sicherheit“, oder die Ärztin/der Arzt am Bett oder Dialyseplatz steht und der Patientin oder dem Patienten versichert: „Herr oder Frau A., ich habe Ihre Werte genau im Blick und melde mich sofort bei Ihnen, falls mir etwas auffällt. Und sagen Sie mir, wenn es Ihnen aus irgendeinem Grund nicht gut geht, wir finden gemeinsam eine Lösung.“
Ein Fachbereich wie die psychosoziale Nephrologie ist lange schon überfällig und ein Schritt in die richtige Richtung. Leider in der Praxis noch nicht “gelebt“. Bei der Nephrologin/ dem Nephrologen jemanden zu haben, der sich im Bereich seelischer Gesundheit auskennt und die Patient:innen rechtzeitig erkennt, wäre ein Vorteil für die Betroffenen, denn Depressivität ist mit fehlender Adhärenz und auch mit erhöhter Mortalität assoziiert. Die psychosoziale Nephrologie als Schnittstelle zwischen Patient:innen und Behandlungsteam bzw. Ärztin/ Arzt könnte und müsste eine weitaus wichtigere Rolle inne haben. Sie könnte durch das, was das Behandlungsteam nicht leisten kann – fehlende Zeit, keine spezielle Ausbildung – für eine Kommunikationsstruktur sorgen, die Depressionen gar nicht erst aufkommen lässt, weil sich die Patientin oder der Patient gut aufgehoben und persönlich gut unterstützt fühlt. Sie oder er hat dann das Erleben von Selbstkontrolle und geht davon aus, dass sie/er die chronische Erkrankung entsprechend gut verarbeiten kann. Sie oder er hadert also nicht voller Angst mit dem Schicksal und dreht keine Gedankenkreise (über den Sinn des Lebens), sondern weiß, dass sie/er das Leben und die Zukunft aktiv mitgestalten kann und dabei Unterstützung bekommt. Diejenige/derjenige gerät also von einem Zustand der Hilflosigkeit in ein Gefühl von Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeitserleben.
Wie kann der Entwicklung einer Depression bei Dialysepatient:innen vorgebeugt werden?
Angenendt: Es gibt verschiedene Arten von Depressionen und eine Reihe von Faktoren, die diese Erkrankung begünstigen. Dialysepatient:innen haben eine Menge Herausforderungen zu bewältigen, abgesehen vom Bewusstsein der eigentlichen Situation, dass sie an einer potenziell infausten Erkrankung leiden und es keine Alternative zur Dialyse gibt außer einer Organtransplantation.
Dialyse heißt: Mindestens 3x wöchentlich für vier Stunden an die Maschine, von der sie – von nun an in vielen Fällen für immer – abhängig sein werden, Nebenwirkung der Dialyse wie Blutdruckabfälle, Arbeitsunfähigkeit durch sehr eingeschränkte Leistungsfähigkeit, massiv reduzierte Flüssigkeitsaufnahme (selbst bei heißen Temperaturen) und vieles mehr. Meinem Ehemann, der unter einer erblichen Zystennierenerkrankung litt, wurde im Alter von 50 Jahren bei einer Routineuntersuchung eröffnet, dass er „jetzt aber bald eine neue Niere“ brauche. „Jetzt geht’s aber erst einmal an die Dialyse, Ihr Nephrologe hat Sie einzuweisen und Ihnen zu erklären, wie Sie fortan zu leben haben“. Sie können sich vorstellen, dass dies ein Beispiel ist, wie es nicht gehen sollte. Ich habe damals begonnen, mich in der Selbsthilfe zu betätigen und sehe durch die eigene Erfahrung die Problematik noch einmal aus einem anderen Blickwinkel. Mein Mann ist inzwischen verstorben, aber ich bin heute noch dabei, um betroffenen Patient:innen in solchen Situationen beizustehen, sie zu begleiten und zu unterstützen, über meine eigentliche Profession hinaus.
Ganz wichtig finde ich, dass schon sehr früh, wenn die Niereninsuffizienz erkannt und mit der Patientin/dem Patienten besprochen wird, darauf hingewiesen wird, dass es da auch eine Anlaufstelle zur Selbsthilfe gibt, die man anrufen kann, wenn man Fragen oder Probleme hat – ohne gleich im ersten Gespräch anzukündigen, dass in der ohnehin schwierigen Situation mit dem Dialysebeginn nun auch vielleicht noch eine Depression droht. Oft ist es ja so, dass die Fragen nicht bei der Ärztin/beim Arzt aufkommen, weil man viel zu aufgeregt ist, sondern sie kommen erst danach. Dann sollte man wissen, dass man diese Anlaufstelle hat, wo man Hilfe bekommt und auch noch einmal wiederkommen kann, wenn man sich vielleicht ein paar Fragen aufgeschrieben hat. Denn Patient:innen benötigen empathische Unterstützung bei der Verarbeitung ihrer Erkrankung. Sie benötigen jemand, dem sie vertrauen und dem sie ihre Ängste und Sorgen „aufbürden“ dürfen. Die Ärztin oder der Arzt, das wissen die Patient:innen, hat dafür keine Zeit, sondern erwartet Zuversicht, sie/ihn will man nicht enttäuschen. Die Schwester, obwohl sehr nett und empathisch, hat viel zu wenig Zeit für all die Patient:innen.
Nach einer größeren Untersuchung des BNeV (Bundesverband Niere e. V.) vor fast 10 Jahren gemeinsam mit dem Verband deutscher Nierenzentren zur Zufriedenheit an der Dialyse haben wir festgestellt, dass sich die Patient:innen nicht gut abgeholt fühlten. Das Selbsthilfenetzwerk mit Sitz in Mainz hat dann zusammen mit den niedergelassenen Dialysepraxen damit begonnen, sogenannte „Patient:innenbegleiter:innen“ ehrenamtlich auszubilden. Diese Menschen sind selber betroffen und kennen die Strapazen sehr gut, die mit Dialyse, Warteliste, Transplantationsvorbereitungen und Ähnlichem verbunden sind. Diese Art der Kommunikation ist im Umgang mit Dialysepatient:innen eine Riesenchance: Da muss nicht viel erzählt werden, der andere weiß, wie es sich anfühlt, auch ohne dass ihm die ganze Geschichte erzählt wird. Mittlerweile gibt es bundesweit ca. 150 ausgebildete Patient:innenbegleiter:innen, und die Rechnung geht auf: Sie beobachten weniger psychische Probleme bei guter Behandlungs- Adhärenz. Da, wo psychische Probleme auftauchen oder schon vorhanden sind, versuchen sie, durch entsprechende Informationen zu helfen bzw. die Patientin/den Patienten dem Hilfesystem zuzuführen. Allerdings gibt es noch viel zu wenige solcher Begleitpersonen.
Abgesehen davon, dass ich sie als wertvolle Ergänzung sehe, denke ich, dass die psychonephrologische Betreuung aber grundsätzlich institutionalisiert und professionalisiert, durch die Sozialgesetzgebung anerkannt und mehr gefördert werden müsste. Da schlummert noch erhebliches Potenzial.
Auf welche Leitsymptome einer Depression sollte in der Dialysepraxis geachtet und der Verdacht fachärztlich bestätigt werden?
Angenendt: Die Leitsymptome einer Depression sind eine dauerhaft traurige Stimmung, Interessenverlust und Freudlosigkeit, ständige Müdigkeit, Energielosigkeit, Konzentrationsprobleme und Probleme, Entscheidungen zu treffen. Ebenso Schlafstörungen wie Ein- und Durchschlafstörungen oder auch frühmorgendliches Erwachen (5 Uhr). Betroffene leiden oftmals unter Gefühlen von Wertlosigkeit oder Schuldgefühlen, bis hin zur Suizidgefährdung, weil sie keinen Sinn mehr im Leben sehen. Auch Appetitverlust zählt zu den Anzeichen einer Depression.
Warum trifft es ca. ein Viertel der Patient:innen (plus vermutlich einer nicht unerhebliche Dunkelziffer) und die anderen nicht? Welche Faktoren verursachen bzw. verstärken das Risiko einer Depression?
Angenendt: Abgesehen von einigen wenigen genetisch bzw. biologisch bedingten Fällen kann man sagen: Letztlich, wenn man es ganz kurz fasst, ist die seelische Erkrankung eine Folge der Bewertung einer Situation durch die Patientin/den Patienten.
Dialysepatient:innen haben vor dem Hintergrund verschiedener bisheriger Lebenserfahrungen sowie unterschiedlicher Persönlichkeitsstile die verschiedenen Herausforderungen, die auf sie zukommen, zu bewältigen. Die Frage ist also: Wie gehe ich womit um? Sie müssen ihren Lebensstil verändern, bestenfalls regelmäßige Bewegung in ihren Tagesablauf einbauen und auf gesunde, genau abgestimmte Ernährung achten, eine Vielzahl von Medikamenten einnehmen (von denen einige depressive Symptome als Nebenwirkung haben können), müssen zum Teil ihre Rolle neu definieren (beispielsweise vom Ernährer zum Patienten oder eine Zukunft ohne die Möglichkeit der Mutterschaft). Einige Patient:innen sind ängstlicher als andere, die vielleicht schon größere Krisen in ihrem Leben gemeistert haben und die die jetzige Gesundheitskrise als „zu bewältigen“ bewerten. Manche Patient:innen resignieren vor den finanziellen Belastungen, die wegen Erwerbslosigkeit oft mit der Erkrankung einhergehen, oder fühlen sich isoliert, weil sie kein familiäres Helfersystem haben, das sich mit kümmert. Dies zeigt noch einmal wie wichtig es ist, jede Patientin und jeden Patienten in ihrem/seinem eigenen „Kosmos“ zu sehen, mit allem, was dazu gehört − also auch den Angehörigen − aber auch mit allem, was fehlt.
Patient:innen wollen bemündigt sein, sie wollen dazu gehören und mit ihrem Dialyseteam gemeinsam Entscheidungen treffen, die für sie selbst substanziell sind. Shared decision making ist in diesem Zusammenhang ein gutes Stichwort. Es gibt den Patient:innen Transparenz über die geplanten Schritte und das Erleben von Kontrolle über ihr/sein Leben beziehungsweise Gesundheit zurück. Und um dies umzusetzen, wäre beispielsweise eine psychosoziale Fachkraft von besonderem Wert, denn sie hätte die Zeit und die Kenntnisse, die es bräuchte, dies gelingen zu lassen.
Welche besonderen Gefahren/Risiken bestehen bei Dialysepatient:innen durch eine Depression? Mit welchen Folgen?
Angenendt: Wie bei allen chronischen körperlichen Erkrankungen besteht auch hier die Gefahr, dass die Patient:innen der angeratenen Therapie nicht mehr folgen können oder schlimmstenfalls wollen. Es gelingt ihnen nicht, ihre Medikamente regelmäßig zu nehmen oder pünktlich zu ärztlichen Terminen/Dialyseterminen zu erscheinen. Schlimmstenfalls können die Folgen vermehrte Krankenhauseinweisungen bis hin zur Behandlungsverweigerung durch die Patientin/den Patienten sein. Es besteht ein erhöhtes Mortalitätsrisiko. Durch eine rechtzeitige Behandlung der Depressionen hätte möglicherweise ein früher Tod vermieden werden können.
Was bedeutet all das für die betreuenden Dialyseärzt:innen in der Routine einer Dialysepraxis? Wann ist eine antidepressive Therapie erforderlich?
Angenendt: Die betreuenden Dialyseärzt:innen sollten über die psychische Situation ihrer Patient:innen informiert sein, denn das vereinfacht den Umgang mit der körperlichen Erkrankung und verhindert schwere Nebenwirkungen, zum Beispiel durch die oben beschriebene, oft auch unbeabsichtigte Non-Compliance. Psychosoziale Fachkräfte für die Nephrologie könnten sozusagen das bislang fehlende Glied sein, das Patient:innen wie Ärzt:innen beziehungsweise Pflegeteam gleichermaßen entlastet und ihnen zu Gute kommt. Selbstverständlich müsste es hierfür ein zusätzliches Budget geben.
Welche nichtmedikamentösen Maßnahmen zur Behandlung der Depression sollten dem Patienten oder der Patientin empfohlen werden?
Angenendt: Mittlerweile gibt es gut untersuchte Verfahren zur Behandlung von Depressionen, die allesamt wirksam sein können. Doch auch hier ist es eine Frage der Persönlichkeit der Patientin/des Patienten: Nicht jedes therapeutische Verfahren ist für jede Patientin/jeden Patienten geeignet. Auch hier ist eine Aufklärung über die verschiedenen Verfahren ratsam, so dass die Patient:innen sich mit der Behandlung identifizieren, vielleicht vorher das ein oder andere ausprobieren können.
Um eine geeignete Behandlerin/einen geeigneten Behandler zu finden, kann man über die Kassenärztlichen Vereinigungen freie Plätze für betreffende Patient:innen anfragen. Theoretisch zumindest, denn leider kann ich da keine großen Hoffnungen machen, weil es schon im Regelbetrieb meines Wissens nach viel zu wenige Plätze gibt und die Patientinnen und Patienten warten bis zu zwei Jahre.
Umso wichtiger wäre es, über die Idee eines Patient:innenbegleiters/einer Patient:innenbegleiterin nach dem eingangs erwähnten Beispiel nachzudenken, die an psychosoziale – therapeutisch ausgebildete – Fachkräfte vermitteln und von der Sozialgesetzgebung anerkannt und finanziert werden.
Als konkrete evidenzbasierte Verfahren haben sich beispielsweise die Kognitive Verhaltenstherapie (CBT) und die Interpersonelle Therapie (IP) bewährt, die jeweils dazu verhelfen können, negative Denkmuster zu identifizieren, zu durchbrechen und gegen gesündere auszutauschen. In den letzten Jahren haben sich mindfulness based Therapieansätze und andere Entspannungstechniken (Yoga, PMR) als seriöse Behandlungsettings erwiesen. Hiermit können Stress abgebaut und depressive Symptome verringert werden.
Last but not least sollte der Fokus auf die Selbstfürsorge gelegt werden, so dass die Patient:innen lernen, sich selber wichtig zu nehmen und sich Zeit zu nehmen, für Dinge, die Ihnen Freude bereiten. Sport und körperliche Aktivität (beispielsweise Bewegung an der Dialyse) gilt als ein wirksames Mittel gegen Depressionen und wird schon in einigen Dialyseeinrichtungen angeboten. Auch gesunde Ernährung und eine gute Schlafhygiene helfen bei der Behandlung von Depressionen. Hierzu gehört zum Beispiel, die Schlafumgebung entspannend zu gestalten, frische Luft zirkulieren zu lassen und regelmäßige Schlafzeiten einzuhalten.
Neben nichtmedikamentösen Therapien steht heute eine Vielzahl von Antidepressiva zur Verfügung. Was ist bei der Behandlung von Depressionen bei Dialysepatient:innen zu beachten?
Angenendt: Antidepressiva sollten immer nur Teil eines Behandlungsplanes sein, der durch nicht-medikamentöse Therapien angeführt wird. Beim Einsatz von Antidepressiva sollte fachübergreifend (Nephrologie und Psychiatrie) geschaut werden, welches Medikament am ehesten in Bezug auf eine Nutzen/Risiko-Abwägung eingesetzt werden kann, denn nicht alle Antidepressiva sind für Dialysepatient:innen geeignet. Mögliche Wechselwirkungen zwischen der bestehenden und der antidepressiven Medikation müssen beachtet werden. Auch können Dialyseverfahren die Konzentration im Blut beeinflussen, so dass es zu empfindlichen Störungen des Befindens kommen kann. Darüber hinaus können Antidepressiva eine Vielzahl von Nebenwirkungen aufweisen, darunter Verwirrtheit, Übelkeit, Erbrechen oder Gewichtszunahme. Besonders zu beachten ist eine Hyponatriämie bei Dialysepatient:innen, da sie zu Krämpfen, Verwirrtheit und sogar zum Koma führen kann.
Kann eine Depression „geheilt“ werden? Wenn ja, wie?
Angenendt: Ja. Depressionen können behandelt und in den meisten Fällen auch geheilt werden. In der Regel kombiniert man verschiedene Verfahren (Psychotherapie, Entspannung, Medikation) miteinander. Ziel ist es, bei der Patientin/dem Patienten eine Einstellungs- und Lebensstiländerung zu bewirken, die es ermöglicht, die Erkrankung als eine zu bewältigende Herausforderung anzunehmen. Hilfreich, damit es vielleicht gar nicht dazu kommt, wären die oben genannten psychosozialen Begleiter:innen am Dialyseort nach dem Vorbild des Selbsthilfenetzwerks Bundesverband Niere e. V. Auch aus prophylaktischer Perspektive wäre dies eine äußerst charmante Möglichkeit, Patient:innen und auch ihren Behandlungsteams viel Unbill zu ersparen.
Patient:innenbegleiter:innen geben bei Diagnostik- oder Behandlungsbedarf an psychosoziale Fachkräfte ab, die ihrerseits durch die Sozialgesetzgebung anerkannt und über die Erhöhung des Dialysebudgets finanziert werden.
Frau Angenendt, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Quelle: Interview
Dieser Beitrag ist ursprünglich erschienen in: Nierenarzt/Nierenärztin 1/2024

