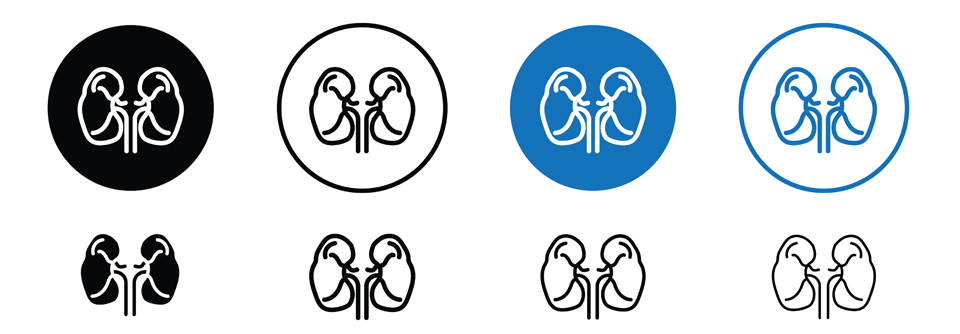Auf Kopf und Nieren prüfen Psychische Komorbiditäten werden in der Nephrologie noch zu wenig beachtet
 Bei der Bewältigung schwerer Nierenleiden sollte man ein Auge auf die Psyche der Erkrankten haben.
© SewcreamStudio - stock.adobe.com
Bei der Bewältigung schwerer Nierenleiden sollte man ein Auge auf die Psyche der Erkrankten haben.
© SewcreamStudio - stock.adobe.com
Die moderne Nephrologie ist biopsychosozial“, stellte Dr. Gerhard Hildenbrand fest, ehemaliger Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum Lüdenscheid. Die Prävalenz für depressive Störungen bei gleichzeitiger terminaler Niereninsuffizienz liegt bei 40 %, in drei von vier Fällen ist die Depression schwer ausgeprägt. Auch Angststörungen, Fatigue und Schlafprobleme treten bei chronischer Nierenerkrankung häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung. Psychische Störungen und ungünstige Krankheitsbewältigungsstile würden bei nephrologisch Erkrankten jedoch zu selten diagnostiziert und behandelt, so Dr. Hildenbrand.
Bereits die Grunderkrankung und die Nebenwirkungen der Dialyse beeinträchtigen das Wohlbefinden und die körperliche Integrität erheblich. Hinzu kommen Komplikationen der Therapie wie ein Shuntverschluss oder Blutungen. Die Erkrankung kann auch die Selbstwahrnehmung und das Körperschema der Betroffenen negativ beeinflussen.
Der hohe zeitliche Aufwand für die Therapie führt zu einschneidenden Veränderungen im Berufsleben, in der Familie und bei Hobbys. Die Erkrankten nehmen oft eine neue Rolle ein, auch weil sie von ihren Angehörigen „geschont“ werden. Nicht selten führt das zu Störungen in Partnerschaft und Sexualleben. Bei der Diagnose gelte es zu beachten, dass Dialysepatientinnen und -patienten negative Gefühle häufig eher körperlich wahrnehmen, etwa in Form von Kopfschmerzen, Herzrasen oder Schwindel, meinte Dr. Hildenbrand.
Selbstbestimmtheit durch Missachtung ärztlichen Rats
Starke Ängste und Depression, aber auch Wut und Frustration können dazu führen, dass die Therapie adhärenz leidet. Dies geschieht entweder aus Antriebslosigkeit oder weil die bewusste Missachtung ärztlicher Ratschläge manchen Betroffenen ein Gefühl von Selbstbestimmtheit zurückgibt.
Insgesamt lässt sich bei 30–60 % der Dialysepatientinnen und -patienten eine mangelnde Adhärenz feststellen. Darunter leiden etwa die Medikamenteneinnahme, Ernährung und Flüssigkeitsrestriktion, Dialysefrequenz und -dauer. Nicht-adhärente Patientinnen und Patienten versterben früher und benötigen häufigere Krankenhausaufenthalte. Dennoch finden sich auf nationaler Ebene in den Guidelines der DGfN und der DEGAM keine Empfehlungen zu einem psychosozialen Management, beklagte der Referent.
In mindestens jährlichem Abstand sollte in der hausärztlichen oder nephrologischen Konsultation die Psyche angesprochen werden und ein kurzes Screening erfolgen, empfahl Dr. Hildenbrand. Dazu eigneten sich verschiedene Instrumente wie der sehr kurze WHO-5-Fragebogen zum Wohlbefinden. Bei positivem Screening soll eine umfassende psychosomatisch-psychotherapeutische Abklärung erfolgen. Allerdings unterzieht sich nur die Hälfte der positiv gescreenten Patientinnen und Patienten einer weitergehenden Diagnostik. Von den Betroffenen mit diagnostizierter Depression nimmt wiederum nur die Hälfte eine adäquate Therapie in Anspruch.
Die meisten Dialysepflichtigen können nicht arbeiten
Auf die Rolle der Erwerbstätigkeit mit chronischer Nierenerkrankung ging Prof. Dr. Thomas Mettang, Nierenzentrum Wiesbaden, ein. Rund 25 % der Hämodialyse-Patientinnen und -patienten sind jünger als 60 Jahre, bei Erkrankten unter Peritonealdialyse sind es mehr als 50 %. Genaue Daten zur Berufsausübung gibt es nicht, aber aufgrund von (v. a. internationalen) Metaanalysen schätzt Prof. Mettang, dass nur rund ein Viertel bis ein Drittel der Dialysebehandelten im erwerbsfähigen Alter einer Arbeit nachgeht.
Neben finanziellen Vorteilen bringe die Erwerbstätigkeit den Betroffenen auch psychische Vorteile, erklärte Prof. Mettang. Sie gehe oft mit größerer sozialer Anerkennung einher und die Erkrankten profitierten von einer festen Struktur im Alltag. Gerade bei den Jüngeren seien Arbeit und Karriere zudem oft auch eine Frage der persönlichen Entwicklung.
Problematisch für die Berufstätigkeit ist vor allem der hohe Zeitaufwand der Dialyse. Die Zentrums-Hämodialyse gibt es zwar auch in einer Nachtversion, die den Betroffenen tagsüber mehr freie Zeit verschafft. Dieses Angebot sei jedoch nicht flächendeckend verfügbar und werde teilweise aus Personalmangel auch wieder abgeschafft, so Prof. Mettang.
Die Peritonealdialyse in den eigenen vier Wänden erleben viele Berufstätige als praktischer; sie setzt jedoch einen stabilen Zustand der Betroffenen und die passende räumliche Ausstattung voraus. Die automatisierte Peritonealdialyse findet nachts zu Hause statt. Sie wird derzeit häufig bei Kindern eingesetzt, ist aber prinzipiell auch für Erwachsene geeignet.
Quelle: 131. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin