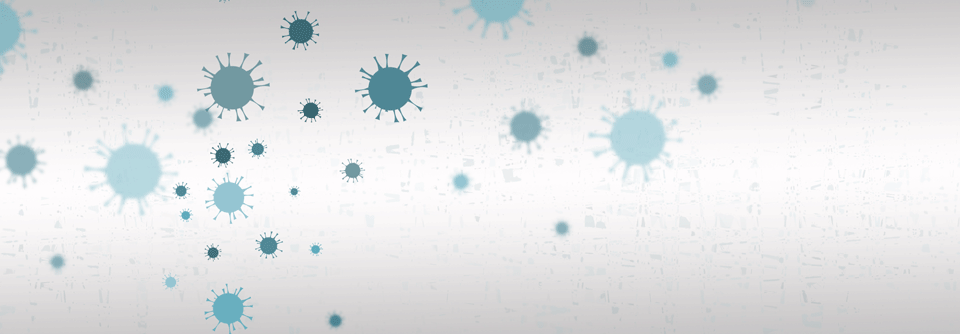Hyposmie nach COVID-19 Schnuppertraining hilft am besten
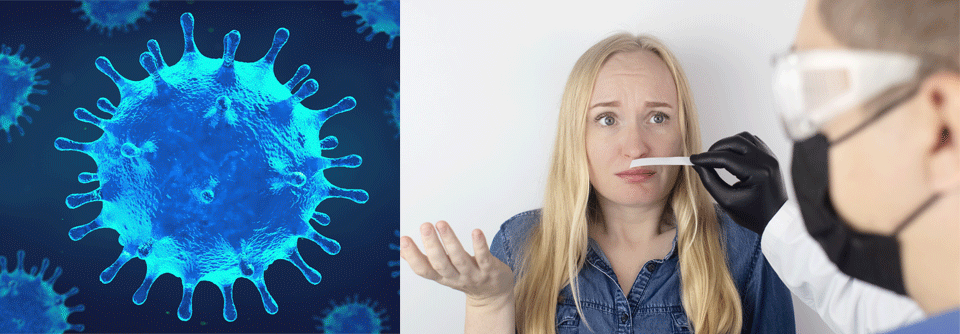 Die Omikron-Variante des Coronavirus verursacht seltener Riechstörungen als ihre Vorgänger.
© Siniehina - stock.adobe.com, Feydzhet Shabanov - stock.adobe.com
Die Omikron-Variante des Coronavirus verursacht seltener Riechstörungen als ihre Vorgänger.
© Siniehina - stock.adobe.com, Feydzhet Shabanov - stock.adobe.com
In den ersten beiden Wellen der SARS-CoV-2-Pandemie lag die Prävalenz von Hyposmien bei etwa 39–47 %, womit diese unter den am häufigsten genannten Symptomen rangierten. Unterscheiden muss man nach Aussage von Dr. Constantin Hintschich vom Uniklinikum Regensburg und Kollegen zwischen einer Riechminderung durch Schwellung und Schleimbildung bei unterschiedlichsten viralen Erkrankungen und einer Riechminderung ohne weitere nasale Symptome. Letzterer begegnete man vor allem in den frühen Phasen der COVID-19-Pandemie.
Spätere Virusvarianten wie Omikron warteten mit einer höheren Übertragbarkeit auf als das Wildtyp-Virus. Mortalität und Morbidität, aber auch Symptome wie der Riechverlust nahmen dabei ab. Die Odds Ratio für eine Riechminderung durch Omikron lag im Vergleich zum Wildtyp bei 0,18.
Parosmien gelten als prognostisch günstig
Während sich der Geruchssinn bei dem Gros der Betroffenen nach einigen Wochen wieder einstellt, persistiert eine Riechminderung bei etwa 5 % noch nach sechs Monaten. Eine anhaltende Hyposmie schränkt die Lebensqualität relevant ein und ist auch mit dem Post-COVID-Syndrom assoziiert. Noch häufiger als Hyposmien sind veränderte Riechwahrnehmungen, die bei über 40 % der Patienten sechs Monate nach der akuten Infektion beobachtet werden. Auch wenn sogenannte Parosmien belastend sein können, interpretiert man sie als prognostisch günstig – nämlich als Ausdruck der Regeneration des Riechvermögens.
Eine weitergehende Diagnostik, vor allem eine HNO-ärztliche Untersuchung, ist bei Symptompersistenz angezeigt. Erfragen sollte man den Beginn und den Verlauf der Erkrankung und die Art der Riech- und auch Schmeckstörungen. Weitere auslösende Faktoren abgesehen von Infekten der oberen Atemwege sind chronische Nasennebenhöhlenentzündungen, Traumata, frühere Operationen oder Bestrahlungen. Auch nach neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen sollte man fragen.
Eine einfache, subjektive Testung des Riechvermögens erfolgt mittels visueller Analogskala. Genauer sind sogenannte psychophysische Tests mit Sniffin’ Sticks, in denen nicht nur Geruchsidentifikation, sondern teils auch Riechschwelle und Geruchsdiskrimination objektiviert werden können. Mit diesen Verfahren ist es auch möglich, Defizite aufzudecken, die im Alltag zunächst nicht bemerkt werden. Außerdem kann man mit den Tests den Verlauf der Riechstörung gut beurteilen. Die Spiegeluntersuchung hilft, chronische Entzündungen, bisweilen auch Tumoren, zu entdecken.
Therapeutisch sehen die Autoren die beste Evidenz für das Riechtraining, welches das Riechvermögen signifikant verbessern kann. Es besteht aus Trainingseinheiten von jeweils 30 Sekunden mit vier verschiedenen Düften zweimal täglich über insgesamt 3–12 Monate. Als Düfte werden z.B. Zitrone, Eukalyptus, Rose und Nelke eingesetzt. Nach 3–4 Monaten wechselt man das Sortiment. Zur Empfehlung weiterer Therapien gibt es den Autoren zufolge noch keine ausreichenden Nutzenbelege. Für intranasale oder systemische Kortikosteroide sehen sie aktuell keinen Stellenwert, auch vor dem Hintergrund der möglichen Nebenwirkungen.
Quelle: Hintschich CA et al. HNO 2023; 71: 739-743; DOI: 10.1007/s00106-023-01368-w