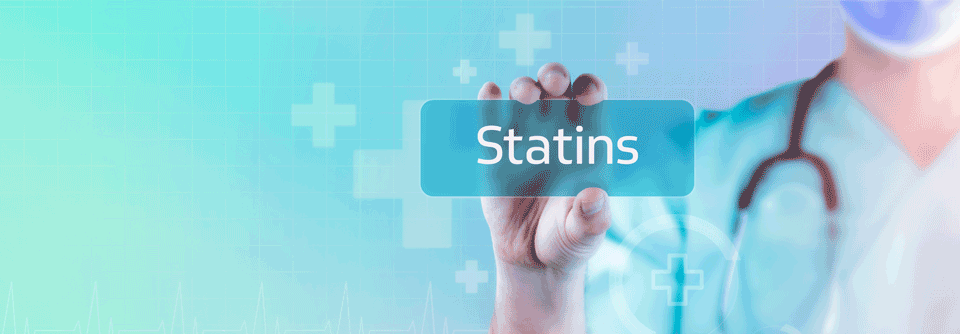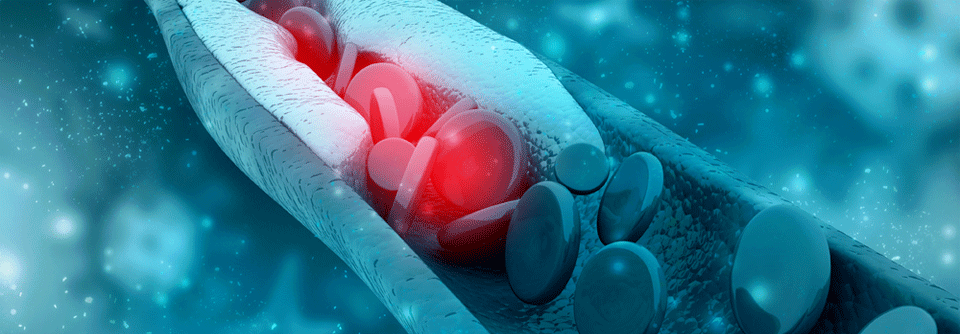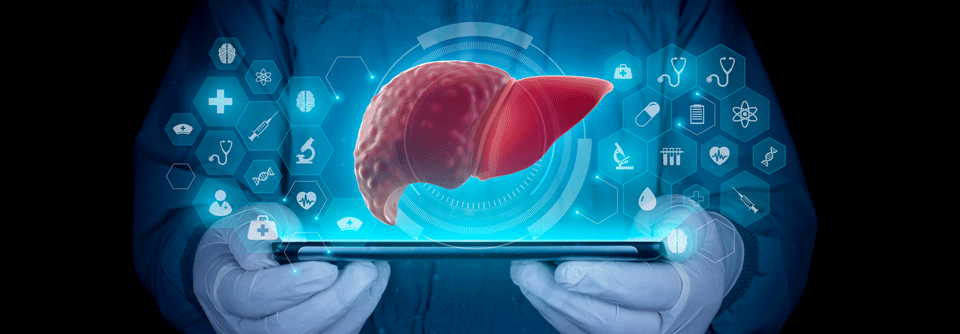
Muskelschmerz durch Statine Toxisch oder immunvermittelt?
 Statine können den Muskel toxisch und immunvermittelt schädigen.
© TeacherPhoto - stock.adobe.com
Statine können den Muskel toxisch und immunvermittelt schädigen.
© TeacherPhoto - stock.adobe.com
Die statininduzierte toxische Myopathie ist relativ häufig, je nach Definition sollen bis zu 13 % der Statinnutzerinnen und -nutzer eine solche entwickeln. Auslöser kann jedes Statin sein, die Beschwerden treten Tage bis Wochen nach der Einnahme auf. Typisch sind Muskelschmerzen, manchmal kommt es auch zu einer Muskelschwäche. Eine Dysphagie oder ein Raynaudphänomen treten bei der toxischen Statinmyopathie nicht auf. Im Labor variiert die Kreatinkinase von normal bis zehnfach erhöht, spezifische Antikörper liegen nicht vor.
Anders die statinassoziierte nekrotisierende autoimmune Myopathie. Sie ist mit zwei bis drei Fällen auf 100.000 Statinnutzerinnen und -nutzer sehr selten und wird insbesondere durch Atorvastatin induziert. Es dauert meist Monate bis Jahre, bis die Beschwerden auftreten, wobei es fast immer zu Kraftminderung, manchmal zu Dysphagie und Myalgie kommt. Auch ein Raynaudphänomen kann sich ausbilden. Die Kreatinkinase ist meist über das Zehnfache erhöht, und immer sind die gegen das Enzym HMG-CoA-Reduktase gerichteten Autoantikörper (HMGCR-Autoantikörper) nachweisbar.
Wird die Statingabe gestoppt, verschwinden die Symptome bei der toxischen Form meist komplett wieder. Es ist sogar möglich, erneut ein Statin zu verordnen, also eine Rechallenge durchzuführen. Die autoimmunvermittelte Myositis zeigt dagegen nach dem Absetzen des Statins keinerlei Rückläufigkeit der Symptome. Eine Rechallenge ist kontraindiziert – eine erneute Statingabe würde die Autoimmunreaktion verstärken und das Fortschreiten der Erkrankung provozieren.
Quelle: Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin