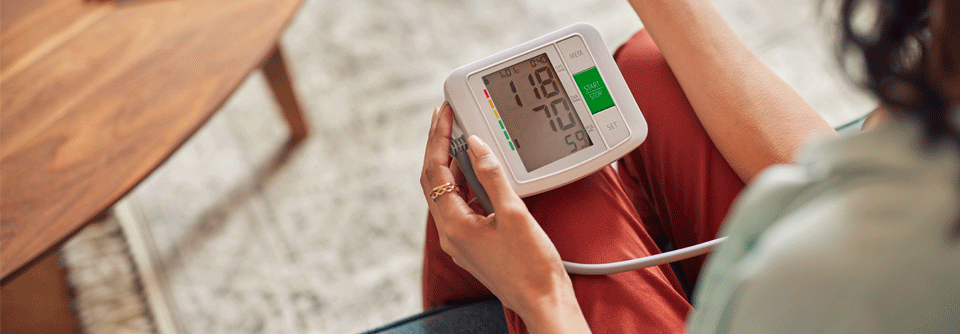Wenn die Klappe Druck macht Vor der Reparatur eines Vitiums sollte man einen Blick auf den Lungenkreislauf werfen
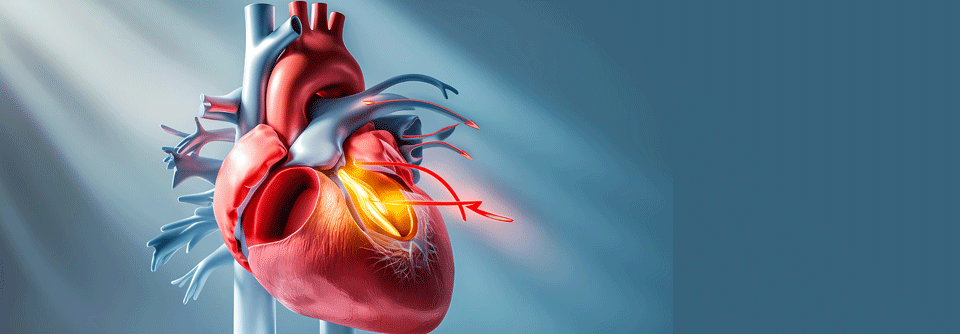 Klappenvitien stehen oft in Verbindung mit einem pulmonalarteriellen Hochdruck.
© britybd007 - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Klappenvitien stehen oft in Verbindung mit einem pulmonalarteriellen Hochdruck.
© britybd007 - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Am häufigsten resultiert die pulmonale Hypertonie (PH) aus einer Linksherzerkrankungen. Sie macht 65–80 % der Fälle aus, erklärte Dr. Kai Helge Schmidt vom Zentrum für Kardiologie der Universitätsmedizin Mainz. Die Inzidenz dürfte mit der Zunahme an linksventrikulären Herzinsuffizienzen steigen. Oft gehen auch Klappenvitien mit einer PH einher. Einen milden Hochdruck im Lungenkreislauf weisen z.B. 32 % der Personen mit Mitralstenose und 23 % derjenigen mit Aortenklappeninsuffizienz auf.
Pathophysiologisch sorgen die steigenden Drucke im linken Herzen für eine Überlastung des Lungenkreislaufs. Es kommt zur endothelialen Dysfunktion der Pulmonalarterien mit Vasokonstriktion, gefolgt vom Remodeling der Venolen, Arteriolen und Kapillaren mit anschließender Rarefizierung der Kapillaren. Man unterscheidet die isoliert postkapilläre PH von der kombiniert prä- und postkapillären.
Das Ganze kann in einer rechtsventrikulären Dysfunktion und einer Entkopplung von rechter Herzkammer und pulmonaler Zirkulation münden, sowie in einer sekundären Trikuspidalklappeninsuffizienz. Diese Insuffizienz wiederum erhöht bei bestehender Herzschwäche die Mortalität. Zudem führt eine PH mit rechtsventrikulärer Dysfunktion bei linkskardialer Erkrankung zu einem Anstieg von Symptomen und Sterblichkeit.
Nach Korrektur eines Vitiums persistiert die PH häufig, was ebenfalls eine hohe Mortalität mit sich bringt. Als Risikofaktoren ließen sich männliches Geschlecht, höheres Alter, Diabetes mellitus, schwerere initiale Beschwerden und ein höherer pulmonal-vaskulärer Widerstand ermitteln.
Bereits ein mäßig erhöhter systolischer
Pulmonalarteriendruck bei bestehender Mitralstenose oder -insuffizienz steigert die Gefahr für ein schlechtes Outcome nach chirurgischer oder interventioneller Klappenkorrektur, sagte Dr. Schmidt.
Liegt eine Aortenstenose vor, so entwickeln etwa 20–30 % aller Patientinnen und Patienten im Verlauf ein Rechtsherzversagen, ergänzte PD Dr. Matti Adam von der Klinik III für Innere Medizin an der Uniklinik Köln. Bei diesem Klappenvitium beeinflusst die pulmonale Hypertonie das Outcome nach Transkatheter Aortenklappenimplantation (TAVI) stark negativ. Vor der Fixierung einer neuen Klappe sollte daher erst die Therapie des Hochdrucks erfolgen, betonte der Kollege.
Nicht zuletzt bestimmt ein PH mit über den Erfolg der interventionellen Behandlung einer Trikuspidalinsuffizienz. Vor der Klappenreparatur sollte daher ein kompletter hämodynamischer Work-up stattfinden. Je nach Befund hat dann ggfs. die Therapie des Lungenhochdrucks Priorität.
*Deutsche Gesellschaft für Kardiologie
Quelle: Jahrestagung der DGK*