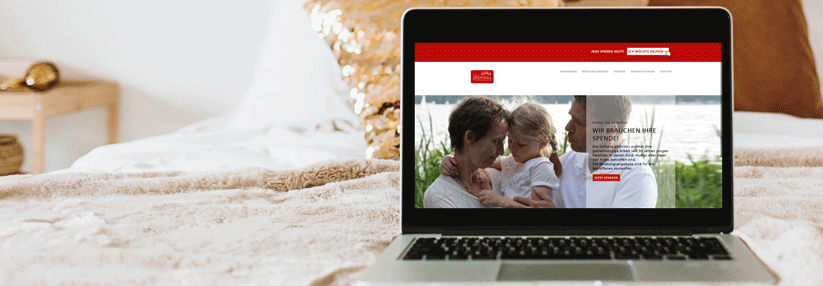Interview mit Prof. Dr. Tanja Zimmermann Was Onkolog:innen und Angehörige tun können, damit die Kleinen nicht vergessen werden
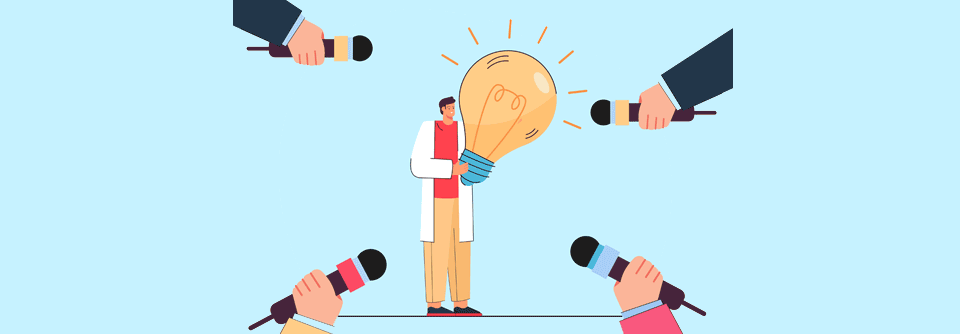 Bei einer Krebsdiagnose brauchen nicht nur die Patient:innen Unterstützung, sondern auch ihre Kinder. Standardmäßige Hilfsangebote gibt es jedoch nicht, und die Betroffenen sind häufig auf Stiftungen und Vereine angewiesen.
© PCH.Vector – stock.adobe.com
Bei einer Krebsdiagnose brauchen nicht nur die Patient:innen Unterstützung, sondern auch ihre Kinder. Standardmäßige Hilfsangebote gibt es jedoch nicht, und die Betroffenen sind häufig auf Stiftungen und Vereine angewiesen.
© PCH.Vector – stock.adobe.com
Frau Prof. Zimmermann, erkrankt ein Elternteil an Krebs, steht er oder sie zunächst im Mittelpunkt. Aber auch die Kinder leiden darunter – was brauchen sie in einer solchen Situation besonders?
Prof. Tanja Zimmermann: Minderjährige Kinder krebskranker Eltern brauchen vor allem eins: Sichtbarkeit. Denn sie werden als belastete Angehörige häufig übersehen. Der Fokus liegt meist ausschließlich auf der erkrankten Person selbst, also der Mutter oder dem Vater. Im klinischen Alltag spielen dabei die Kinder der Betroffenen leider nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle. Eltern und Kinder fühlen sich dadurch häufig allein gelassen.
Wie soll die Kommunikation mit den Kindern erfolgen? Soll man sie mit einbeziehen?
Prof. Zimmermann: Eltern stellen mir sehr häufig die Frage, ob sie ihrem Kind sagen sollen, dass sie Krebs haben. Die Antwort ist: ja! Das hat verschiedene Gründe. Kinder merken, wenn irgendetwas nicht stimmt. Sie besitzen feine emotionale Antennen und spüren Veränderungen sehr schnell. Wissen sie aber nicht, was genau passiert, beziehen sie das meist auf sich selbst und fragen sich, ob sie etwas falsch gemacht haben.
Kinder haben, je nach Alter, eine egozentrische Sichtweise und denken, dass sie mit ihrem Verhalten bestimmte Dinge beeinflussen können. Sie suchen die Schuld bei sich und verfallen in Aktivismus, in der Hoffnung, dass dann alles wieder gut wird. Daher ist es immens wichtig, sie über die elterliche Tumorerkrankung zu informieren. Dazu gehört nicht nur die Erklärung, was Krebs bedeutet, sondern auch, dass die Kinder oder ihr Verhalten an der Krankheit keine Schuld tragen. Und: dass sie nichts tun können, damit der Krebs verschwindet. Man muss ihnen den Druck nehmen. Auch für die Eltern wird dann die Situation leichter, denn sie müssen nichts mehr verheimlichen und können in der Familie offen sprechen.
Was man nicht vergessen darf: Kinder können von anderen, zum Beispiel in der Schule, erfahren, dass Mutter oder Vater Krebs hat. Ich selbst betreute vor einiger Zeit eine Familie, in der sich dieses Szenario abspielte. Die zwölfjährige Tochter wurde nicht von ihren Eltern informiert, hat es aber von anderer Stelle erfahren. Sie traute sich nicht, danach zu fragen, weil sie dachte, sie dürfe nicht darüber reden, und war sehr allein mit ihrer Verunsicherung.
Wichtig ist es, den Kindern die Wahrheit zu sagen. Das bedeutet nicht, dass man jedes Detail erzählen muss – aber das, was man sagt, sollte der Wahrheit entsprechen. Wir empfehlen, auf jeden Fall das Wort „Krebs“ zu verwenden. Die Assoziation „Krebs bedeutet Tod“ haben nur wir Erwachsene; Kinder stellen diesen Zusammenhang nicht her.
Wie können speziell Onkolog:innen die Betroffenen unterstützen?
Prof. Zimmermann: Ich würde mir wünschen, dass die behandelnden Onkolog:innen ihre Patient:innen aktiv fragen, ob sie Kinder haben und ob diese über die Diagnose Bescheid wissen. Das passiert in vielen Fällen schon, oftmals aber noch nicht. In zertifizierten Zentren gibt es eine Psychoonkologie, auf die die Onkolog:innen hinweisen können. Die psychoonkologische Unterstützung steht sowohl den Erkrankten selbst als auch ihren Angehörigen zur Verfügung. Man sollte aber die Kinder nicht drängen – sie selbst bestimmen das Tempo.
Ich fände es außerdem toll, wenn die Behandelnden der Mutter oder dem Vater anbieten, das Kind zur Therapie oder zum Gespräch mitzubringen. Gerade kleinere Kinder sind sehr interessiert daran, was genau während der Behandlung passiert. Erklärt man es ihnen, nimmt man dem Ganzen den Schrecken. Onkolog:innen können sehr viel dazu beitragen, indem sie ein offenes Umfeld schaffen. Damit können sie auch die Unsicherheiten der Eltern reduzieren.
Für die Kommunikation kann man unterstützend Bücher z.B. von der Deutschen Krebshilfe oder der Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe verwenden, in denen z.B. Chemo- und Strahlentherapie kindgerecht erklärt werden. Fällt es den Onkolog:innen selbst schwer, mit den Kindern zu sprechen, kann vielleicht ein Teammitglied dabei unterstützen.
Hier finden Familien Unterstützung
- Flüsterpost e.V. Mainz: Unterstützung für Kinder krebskranker Eltern. https://kinder-krebskranker-eltern.de/
- ANKER – Angebot des Universitätsklinikums Heidelberg. https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/sonstige-seiten/kinder-krebskranker-eltern
- Studie „Liebend gern erziehen – trotz Krebs“. www.seiteanseite.de
- phönikks Stiftung | Krebsberatung für Familien – Krebsberatungsstelle Hamburg (phoenikks.de)
- Hilfen für Angehörige. Broschüre in der Reihe „Die blauen Ratgeber“ (Nr. 42). https://www.krebshilfe.de/infomaterial/Blaue_Ratgeber/Hilfen-fuer-Angehoerige_BlaueRatgeber_DeutscheKrebshilfe.pdf
- Krebsinformationsdienst: Krankheitsverarbeitung. Mit Kindern über Krebs sprechen. https://www.krebsinformationsdienst.de/leben/krankheitsverarbeitung/kindern-krebs-erklaeren.php
- Erklärvideos – Deutsche Krebshilfe. https://www.krebshilfe.de/blog/kindern-krebs-erklaeren/
- Über Familien-SCOUT (ukaachen.de)
Unter welchen psychischen Folgen leiden die Kinder?
Prof. Zimmermann: Spezielle Forschung zu diesem Gebiet existierte lange nicht. Wir wissen also nicht, wie genau sich die elterliche Tumorerkrankung psychisch auf das Kind langfristig auswirkt. Bekannt ist aber, dass sie einen Risikofaktor unter anderem für die psychische Entwicklung darstellt. Uns fehlen aber Längsschnittstudien, die dies belegen. Nichtsdestotrotz ist es eine belastende Situation für die gesamte Familie, die Änderungen und Anpassungen erforderlich macht.
Die wenigen Studien, die uns zurzeit vorliegen, haben ergeben, dass die betroffenen Kinder psychisch nicht unbedingt auffälliger sind als andere Gleichaltrige. Für diese Untersuchungen schätzten aber die Eltern selbst die psychische Gesundheit ihrer Kinder ein, und das zu einem Zeitpunkt, an dem sie, aufgrund der eigenen Belastung, dazu wahrscheinlich nicht gut in der Lage waren. Es gibt einige Studien aus dem skandinavischen Raum zu Müttern mit Brustkrebs, die ergaben, dass die Töchter höhere psychische Auffälligkeiten im Jugendalter zeigten.
Wie können die Patient:innen allgemein unterstützt werden und gibt es spezielle Angebote?
Prof. Zimmermann: Zunächst gilt es, die Kinder altersangemessen in den Prozess der Erkrankung mit einzubeziehen. Sie kommen dann besser mit der Situation zurecht und perspektivisch stärkt das ihr Selbstbewusstsein. Sie müssen aber trotzdem noch Kind sein dürfen, sollten weiterhin ihren Hobbies nachgehen und nicht plötzlich das Leben eines kleinen Erwachsenen führen müssen.
Unterstützungsangebote speziell für Kinder krebskranker Eltern sind leider nicht deutschlandweit verfügbar. Ein paar Schwerpunktkliniken, zum Beispiel in Hamburg, bieten spezielle Beratungen an. In Aachen gibt es Familien-Scouts, die die Betroffenen zu Hause besuchen. Es handelt sich dabei um ein Innovationsfondsprojekt. Einige Krebsberatungsstellen haben sich auf das Thema spezialisiert. Ein Beispiel ist die PHOENIKKS-Stiftung, deren Schwerpunkt auf der Familienbetreuung liegt. Es gibt auch einige Vereine (siehe Kasten). Von standardmäßigen Angeboten sind wir aber noch weit entfernt und es existieren keinerlei Möglichkeiten, die Kinder zu unterstützen.
Was muss sich auf politischer Ebene verbessern, damit die Kinder besser betreut werden können?
Prof. Zimmermann: Wir sprechen hier über einen Unterstützungsbereich, der zu den „nice-to-have“-Angeboten gehört. In zertifizierten Kliniken ist die Psychoonkologie Pflicht, diese bewegt sich aber meist am unteren personellen Limit. Oft gibt es nur eine Psychoonkologin oder einen Psychoonkologen pro Klinik und es besteht ein großes Versorgungsdefizit. Wir gehen dabei hauptsächlich in Richtung Prävention, d.h. wir wollen durch unsere Arbeit verhindern, dass es zu psychischen Auffälligkeiten kommt. Und wir alle wissen, wie es um die Prävention in Deutschland bestellt ist. Ich fände es aber enorm wichtig, präventiv anzusetzen.
Und: wir müssen oftmals gar nicht mit den Kindern arbeiten. Oft reicht es aus, die Eltern zu stärken und ihnen zu erklären, was ihre Kinder in der jetzigen Situation brauchen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass unter einer Krebserkrankung Erziehungskompetenzen plötzlich wegbrechen. Wichtig ist es aber auch in dieser schwierigen Situation, den Kindern Grenzen zu setzen, aber dennoch eine liebevolle Beziehung zu erhalten. Wir führen gerade eine Studie durch namens „Liebend gern erziehen – trotz Krebs“, in deren Rahmen wir ein Onlineelterntraining speziell für Eltern, die an Krebs erkrankt sind, anbieten. Darin geht es darum, wie man die Beziehung zu seinem Kind gut gestalten und wünschenswertes Verhalten fördern kann und außerdem, wie man mit Problemen umgeht.
Interview: Dr. Miriam Sonnet