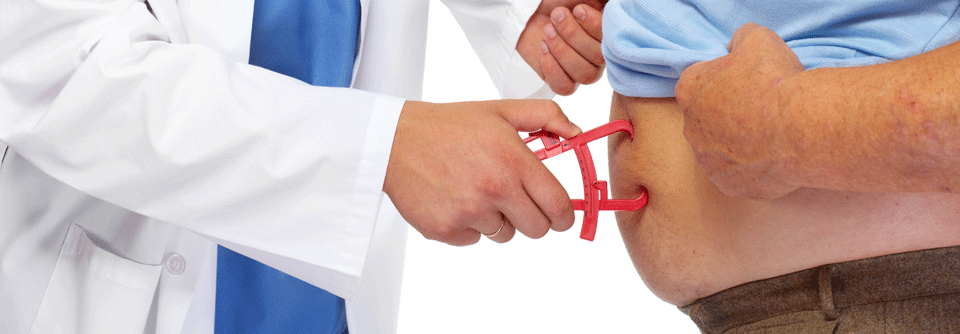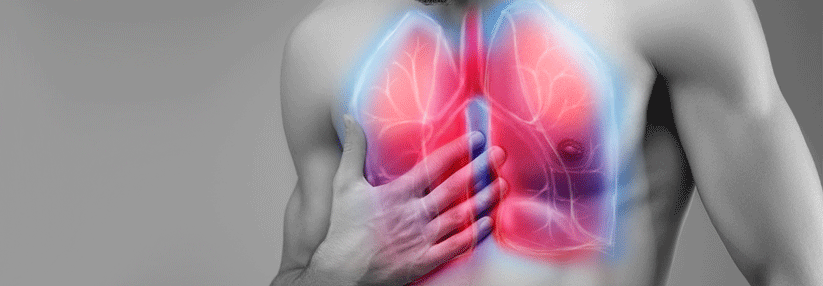
Wenn Arbeit lungenkrank macht Neue Empfehlungen zur Berufskrankheit Silikose
 Wer über Jahre Quarzstaub einatmet, riskiert bleibende Lungenschäden.
© BPawesome - stock.adobe.com
Wer über Jahre Quarzstaub einatmet, riskiert bleibende Lungenschäden.
© BPawesome - stock.adobe.com
Was haben Steinmetze, Bergleute und Angestellte im Straßenbau gemeinsam? Sie alle atmen Quarzstaub ein. Die regelmäßige Inhalation der feinen Partikel kann Lungenkrankheiten wie die Silikose, auch Quarzstaublunge genannt, auslösen. Geführt wird sie als Berufskrankheit Nr. 4101, wobei das Ausmaß der Exposition je nach Berufsgruppe sehr unterschiedlich sein kann. Die kürzlich überarbeitete S2k-Leitlinie der DGP und weiterer Fachgesellschaften bietet aktualisierte Empfehlungen – vor allem zu Diagnostik und Therapie.
Quarzstaub mit kristallinem Siliziumdioxid ist alveolengängig und löst die Silikose aus. Zwei Krankheitsbilder sind zu unterscheiden:
- klassische Silikose, die durch das Einatmen von nahezu reinem Quarzstaub entsteht
- Mischstaubpneumokoniose der Bergleute, die durch Inhalation von Staubgemischen hervorgerufen wird (z. B. Anthrakosilikose durch Quarz und Kohle)
Bei allen Formen treten häufig Symptome wie Husten, Auswurf und Dyspnoe auf. Über eine Dekonditionierung von Atmung, Herz, Kreislauf und Muskulatur kann es zu einer Abwärtsspirale der körperlichen Leistungsfähigkeit und der Lebensqualität kommen. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Lungenkarzinoms.
Der Verdacht auf eine Silikose wurde bisher bei gegebener Quarzstaubexposition anhand eines Röntgenthorax bestätigt. Konventionelles Röntgen spielt dabei nach wie vor eine Rolle, die überarbeitete Leitlinie rückt jedoch die Computertomografie stärker in den Vordergrund. Vor einer Indikationsstellung sind ggf. bereits vorliegende CT-Aufnahmen zu begutachten.
Berufsfelder mit Silikoserisiko
Das Arbeiten in den folgenden Branchen ist häufig mit der Exposition gegenüber quarzhaltigen Stäuben verbunden. Diese entstehen entweder direkt beim Abbau von Granit, Sand, Erz und Kohle oder z. B. beim Umgang mit Glasschmelzen, Schlackeprodukten, Schamott- und Ziegelsteinen, Schleif- und Poliermitteln:
- Steinbruchindustrie
- Steinkohlen- und Erzbergbau
- Email-, Glas-, keramische Industrie
- Stahl- und Eisenindustrie, Gießerei
- Straßen- und Tunnelbau
- Natur- und Kunststeinbearbeitung
- Dentallabor, Elektrotechnik, Halbleiterproduktion, chemische Industrie etc.
In fortgeschrittenen Fällen bis zu 1 cm große Schwielen
Im Röntgenbild fallen die klassischen Charakteristika der Silikose auf: disseminierte, mehr oder weniger scharf berandete, kleine rundliche bis ovale Schatten. Diese treten vor allem in den Oberfeldern auf und nehmen von kranial nach kaudal ab. Bei der fortgeschrittenen komplizierten Staublunge kommt es zu über 1 cm großen Konsolidierungen, den sogenannten Schwielen. Häufig sind auch die hilären und mediastinalen Lymphknoten betroffen. Im Rahmen einer Verkalkung an diesen Orten spricht man von einer „Eierschalensilikose“.
Typische CT-Befunde sind kleine, scharf begrenzte, rundliche Verdichtungen. Anhand der Größe werden sie in drei Gruppen unterteilt:
- P (< 1,5 mm)
- Q (1,5–3 mm)
- R (3–10 mm)
Bei bestehender Quarzstaubexposition gelten folgende Kriterien als hinweisend für eine Silikose: kleine rundliche Schatten vom Typ P, Q oder R mit einem Streuungsgrad von mindestens 1/1 und einem apikobasalen Gradienten im posterior-anterioren Röntgenthorax. Dies gilt auch für den alleinigen Nachweis von eierschalenartig oder grobschollig veränderten verkalkten Lymphknoten.
Erregernachweise im Sputum können falsch negativ sein
Neben den typischen Verläufen gibt es seltenere Formen und Begleiterkrankungen. Kommt es beispielsweise zusätzlich zu einer Tuberkulose, spricht man von Silikotuberkulose. Die Diagnose gestaltet sich oft schwierig, da Erregernachweise im Sputum negativ sein können. Die Therapie erfolgt wie üblich bei Tuberkulose mit einer zweimonatigen Initialtherapie, gefolgt von einer Erhaltungsphase über sechs bis zehn Monate.
Die Silikose kann zudem mit Autoimmunerkrankungen wie Sarkoidose oder rheumatoide Arthritis einhergehen. Bei Quarzstaubexposition soll eine formlose Meldung an die Unfallversicherung erfolgen, um eine spätere Anerkennung als „Wie-Berufskrankheit“ zu ermöglichen, lautet die Leitlinienempfehlung.
Eine besondere Verlaufsform ist die akute Silikose (Silikoproteinose). Sie entsteht durch eine hohe SiO2-Belastung über Monate bis wenige Jahre. Zu den Symptomen zählen Husten, Luftnot, Brustschmerzen und Allgemeinsymptome wie Fieber und Gewichtsverlust. Die Prognose ist meist gut, es kann aber zur Lungenfibrose kommen.
Quelle: S2k-Leitlinie „Diagnostik und Begutachtung der Berufskrankheit Nr. 4101 (Silikose) der Berufskrankheitenverordnung“; AWMF-Register-Nr. 020-010; www.awmf.org