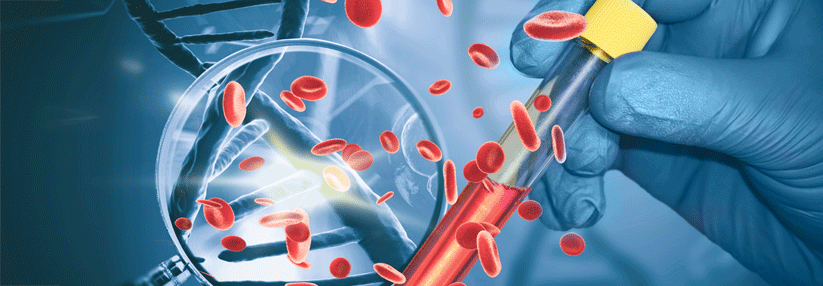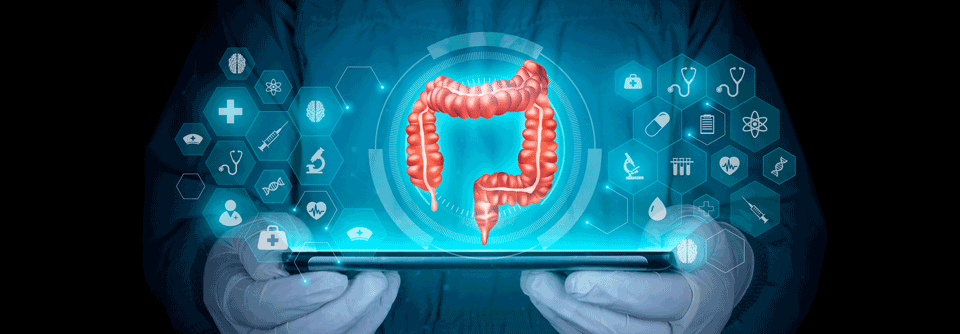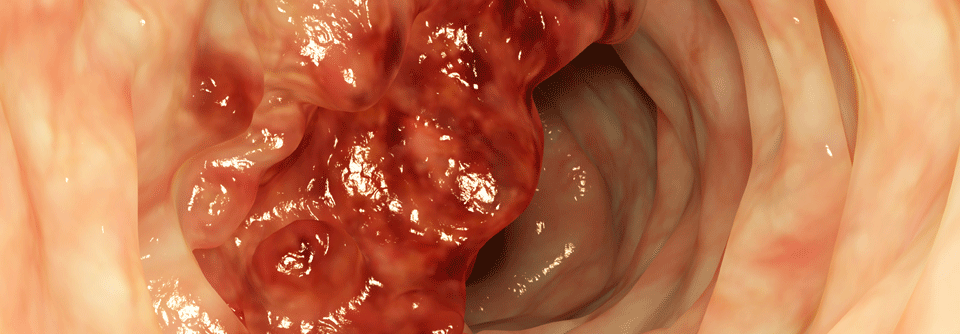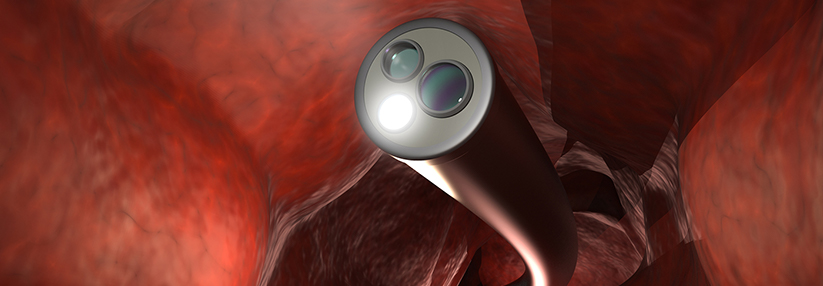
Darmkrebs Wenn ein lokal fortgeschrittenes Kolonkarzinom mit dMMR/MSI durchschlagend anspricht
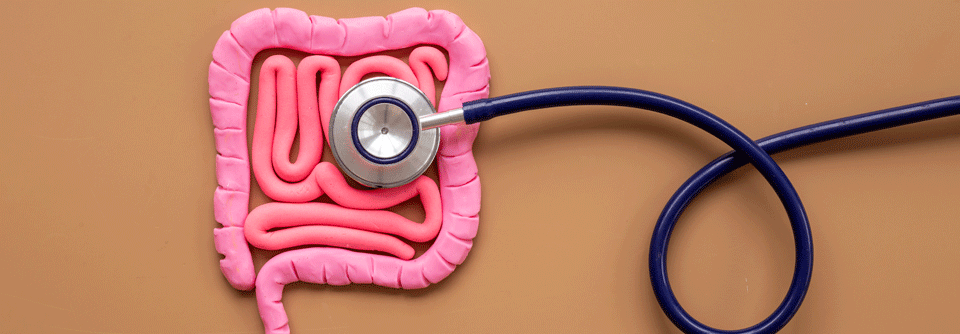 Bei lokal fortgeschrittenem Kolonkarzinom mit MSI/dMMR ist der Organerhalt umstritten und wird kontrovers diskutiert.
© 9dreamstudio – stock.adobe.com
Bei lokal fortgeschrittenem Kolonkarzinom mit MSI/dMMR ist der Organerhalt umstritten und wird kontrovers diskutiert.
© 9dreamstudio – stock.adobe.com
Man sollte definitiv einen Organerhalt beim dMMR/MSI Kolonkarzinom anbieten, sagte Dr. Dr. Myriam Chalabi, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam.1 Als Argument führte sie eine effektive neoadjuvante Checkpoint-Inhibition mit kurz- und langfristiger Wirksamkeit an. Zudem mindere ein organerhaltender Ansatz die Morbidität und Mortalität der Operation, verhindere multiviszerale Operationen bei ausgedehnten Tumoren und sei finanziell günstiger als ein operativer Eingriff.
Als Beleg für die Wirksamkeit neoadjuvanter Immuntherapien verwies die Referentin auf die Daten der Phase-2-Studie NICHE-2. In dieser erreichten Nivolumab plus Ipilimumab in der Neoadjuvanz ein pathologisches Ansprechen bei 98 % und eine pathologische Komplettremission (pCR) bei 68 % der Behandelten – bei einer Drei-Jahres-Rate für das krankheitsfreie Überleben von 100 %. Die Kolon-Chirurgie gehe zudem mit einer Mortalität von bis zu 7 %, einer Morbidität von bis zu 64 % und einer Grad-3/4-Komplikationsrate von 13–20 % einher, speziell bei sehr fortgeschrittenen Tumoren. Im Vergleich dazu liege die Rate an Grad-3/4-Komplikationen bei der neoadjuvanten Immuntherapie oft unter 10 %. Die Erkrankten schätzten zudem die gute Lebensqualität mit dem organerhaltenden Vorgehen, auch wenn es regelmäßige Koloskopien erfordere.
Abschließend erinnerte Dr. Chalabi an gute Erfahrungen mit Organerhalt beim Rektumkarzinom nach neoadjuvanter Therapie mit Dostarlimab. In einer Studie sei es bei niemandem unter 24 Behandelten binnen eines Jahres zu einem Rezidiv gekommen – ohne Radio(chemo)therapie oder nachfolgende Operation. Beim Kolonkarzinom könne ggf. die Bestimmung zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA) dazu genutzt werden, Erkrankte auszuwählen, die besonders für einen Organerhalt infrage kämen.
Organerhalt bei Kolonkarzinom
Prädestiniert dafür sind der Expertin zufolge Betroffene mit Kolonkarzinomen jeglichen Stadiums, die ein solches Vorgehen wünschen, ferner gebrechliche, für eine Operation nicht geeignete Patient:innen sowie jene mit obstruktiven Tumoren oder multiviszeraler Beteiligung. Die strikte Teilnahme an einem Wait-and-See-Überwachungsprogramm bleibe allerdings Pflicht. Aktuell sollte ein organerhaltendes Vorgehen nur in Zentren mit besonderer Expertise und im Rahmen von klinischen Studien erfolgen.
Dr. Dr. Laura Fernandez, Champalimaud Clinical Centre, Lissabon, hielt dagegen, dass aus ihrer Sicht das organerhaltende Vorgehen beim mikrosatelliteninstabilen Kolonkarzinom die schlechtere Alternative gegenüber der Operation darstelle.2 Insbesondere ließ die Viszeralchirurgin Chalabis Hinweis auf gute Erfahrungen beim Rektumkarzinom nicht gelten. Dort gestalte sich die Chirurgie schwierig und gehe mit hoher Morbidität (38 %) und Mortalität (2–3 %; bei über 80-Jährigen > 16 %), insbesondere aber mit zahlreichen Dysfunktionen wie Harnfunktionsstörungen, sexuellen Störungen, Stuhlinkontinenz und einem temporären (> 50 %) oder permanenten Stoma (> 10 %) einher. Deshalb gelte das Prinzip, Operationen beim Rektumkarzinom möglichst zu vermeiden. Mehr als 20 Jahre lang hätten sich Watch-und-Wait-Strategien etabliert, seit Kurzem zusammen mit neoadjuvanter Immuntherapie.
All dies treffe beim Kolonkarzinom aber nicht zu. Hier sei das Risiko funktionaler Beeinträchtigungen „minimal“, die Häufigkeit einer Anastosmoseninsuffizienz liege unter 5 % und ein permanentes Stoma brauche es in weniger als 1 % der Fälle. Hinzu komme das Problem, dass das CT-Staging beim Kolonkarzinom in 25 % der Fälle zu einer Über-, in 50 % aber auch zu einer Unterschätzung führe. Dadurch würden zwei Drittel der pT4-Tumoren und 30 % der pN+-Tumoren nicht entdeckt. Es gebe zudem bei dieser Entität kein etabliertes Verfahren zum Nachweis eines Ansprechens. „Beim Kolonkarzinom ist die Chirurgie sicher, das Staging schlecht und Überwachungstools fehlen“, brachte es die Expertin auf den Punkt. Hohe Ansprechraten einer neoadjuvanten Immuntherapie lieferten keinen Grund, die einfache und kurative Kolektomie zu überspringen. „Eine neoadjuvante Immuntherapie kann möglicherweise ein paar Ausreißern helfen, aber für die meisten bleibt die sichere Operation die beste Option“, so das Fazit von Dr. Fernandez.
Quellen:
1. Chalabi M. ESMO Gastrointestinal Cancers Congress 2025; Controversy Session „Organ preservation in MSI colon cancer – Pro“
2. Fernandez L. ESMO Gastrointestinal Cancers Congress 2025; Controversy Session „Organ preservation in MSI colon cancer – Con“