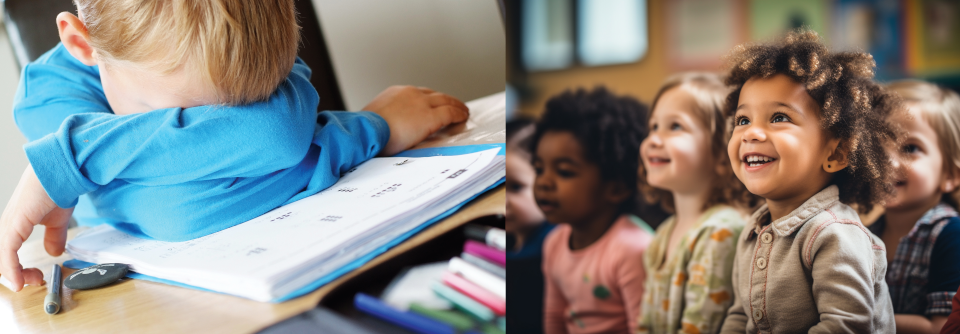Risiko Transitionsphase Wenn Jugendliche aus dem medizinischen System fallen
 Der Übergang von Jugendlichen aus der pädiatrischen in die Erwachsenenversorgung ist vor allem bei chronisch Erkrankten ein heikler Prozess.
© Halfpoint - stock.adobe.com
Der Übergang von Jugendlichen aus der pädiatrischen in die Erwachsenenversorgung ist vor allem bei chronisch Erkrankten ein heikler Prozess.
© Halfpoint - stock.adobe.com
Der Übergang von Jugendlichen aus der pädiatrischen in die Erwachsenenversorgung ist vor allem bei chronisch Erkrankten ein heikler Prozess. Bei jungen Patientinnen und Patienten mit CED und Lebererkrankungen zeigt sich besonders deutlich, wie groß die Versorgungslücke ist.
Rund 800 bis 1.500 junge Menschen pro Jahr erkranken in Deutschland an chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) – oft in der pubertären Phase, in der sie ohnehin mit körperlichen und sozialen Umbrüchen ringen. Kommt dann ein abrupter Wechsel der medizinischen Versorgung hinzu, steigt bei CED-Betroffenen das Risiko für eine Krankheitsprogression.
Birgit Kaltz, stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV e. V.) in Berlin betonte den Unterschied zwischen der Transition als geplantem Prozess und dem Transfer. Bei Letzterem handelt es sich um die bloße Übergabe, ohne die jungen Menschen und ihre Eltern darauf vorzubereiten. „Es darf nicht sein, dass die kritische Phase des Übergangs in der Versorgung dazu führt, dass die Jugendlichen für einen kurzen oder längeren Zeitraum den Kontakt zu der notwendigen Spezialversorgung verlieren und sich erst dann in den fachlich qualifizierten Einrichtungen der Erwachsenenmedizin vorstellen, wenn bereits Komplikationen aufgetreten sind“, betonte die Referentin.
Jugendliche müssen reif genug für die Verantwortung sein
Damit die Transition gelingt, müssen alle Beteiligten gewisse Voraussetzungen mitbringen. „Die Eltern müssen lernen, die Verantwortung abzugeben“, so Kaltz. Umgekehrt müssen die jungen Erwachsenen die Reife besitzen, ihre Erkrankung Schritt für Schritt selbst zu managen: Termine vereinbaren und wahrnehmen, die Medikation eigenverantwortlich in die Hand nehmen und wissen, was bei einem Krankheitsschub zu tun ist. Die Basis hierfür ist das medizinische Verständnis ihrer eigenen Erkrankung.
Doch auch auf Seiten der Erwachsenenmedizin stellt die Übernahme der Jugendlichen oft eine Herausforderung dar. Häufig fehlt der Blick für die physischen und psychischen Besonderheiten der Pubertät. Chronische Inflammation oder Mangelernährung können Wachstum und Entwicklung verzögern. Darüber hinaus sind nicht alle auf dem Markt befindlichen Medikamente für Kinder und Jugendliche zugelassen. Als Patientenvertreterin wünscht sich die Referentin einen strukturierten Transitionsprozess, der medizinische, psychosoziale und pädagogische Aspekte einbezieht. Dieser ist bislang jedoch die Ausnahme und basiert meist auf der Initiative Einzelner, kritisierte sie.
Wie Transition gelingen kann, erklärte Prof. Dr. Petra May vom Universitätsklinikum Düsseldorf am Beispiel des Berliner Transitionsprogramms. Es ist derzeit eines der wenigen Projekte, das von einigen Krankenkassen finanziell unterstützt wird und sich explizit an den Bedürfnissen junger chronisch kranker Menschen orientiert. Zentraler Bestandteil des Konzepts sind Fallmanagerinnen bzw. Fallmanager, die eine wichtige koordinierende Funktion innehaben und den Übergang aktiv begleiten. Aus Sicht von Prof. May sollte eine strukturierte Transition die folgenden Elemente des Berliner Modells beinhalten:
- Fallmanagement (Klärung der Transitionsbereitschaft, individueller Plan, Monitoring, Sozialberatung)
- Transitionsgespräch (Schulung, ggf. Einbeziehung der Eltern, psychologische Evaluation)
- Epikrise (siehe Kasten)
- ggf. gemeinsame Sprechstunde
- ggf. Fallkonferenz zwischen pädiatrischen und erwachsenengastroenterologischen Kolleginnen und Kollegen
Spätestens wenn es um individuelle Pläne mit Berücksichtigung von Sozialfaktoren geht, ist das laut Prof. May realistisch gesehen im Klinikalltag aus personellen und zeitlichen Gründen nicht leistbar. „Die personellen Ressourcen sind viel geringer. Es ist teilweise ein Kulturschock für die Patienten zu sehen, wie wenig Pflegepersonal vorhanden ist.“
Wie komplex sich die Transition gestalten kann, verdeutlicht die Bandbreite pädiatrischer Erkrankungen der Leber: Ob Gallengangsatresie oder genetisch-cholestatische Leberkrankheiten, die unbehandelt zu einem Organversagen führen können – für viele seltene Erkrankungen fehlt Erwachsenenmedizinerinnen und -medizinern die spezifische Erfahrung. Prof. Dr. Philip Bufler von der Charité – Universitätsmedizin Berlin machte deutlich, wie häufig in der Gruppe junger Lebererkrankter fatale Versorgungslücken entstehen.
Die strukturierte Epikrise als Herzstück der Transition
Kernelement eines gelungenen Transitionsprozesses ist eine vollständige Informationsübermittlung im Rahmen einer strukturierten Epikrise. Diese umfasst die folgenden acht Punkte:
- Information zur Diagnose
- Krankheits- und Behandlungsverlauf
- Begleiterkrankungen und Zusatzdiagnosen
- relevante Befunde
- Informationen zur Person (Sozial- und Familienanamnese, ggf. psychosoziale Problembereiche)
- Informationen über Beratungen z.B. zu genetischen oder sozialrechtlichen Fragen
- Empfehlungen für die weitere Behandlung
- Kontaktdaten von Mitbehandelnden
In manchen Fällen wird die Medikation nicht fortgeführt
Eine US-amerikanische Studie zeigte, dass fast ein Fünftel der chronisch lebererkrankten bzw. lebertransplantierten Jugendlichen während der Transitionsphase nicht ausreichend mit Medikamenten versorgt war. Ebenso alarmierend war, dass 20 % der Studienteilnehmenden für sechs bis zwölf Monate keinen Kontrolltermin hatten und bei ebenso vielen der Erstkontakt zur Erwachsenenmedizin in der Notaufnahme stattfand. Ein positives Beispiel liefert eine Studie aus Birmingham mit 137 lebertransplantierten Jugendlichen. Durch enge Zusammenarbeit von Kinder- und Erwachsenenmedizin im Transitionsprozess wurden bzgl. Langzeit-Outcome und Transplantatüberleben gute Ergebnisse erzielt, die vergleichbar waren mit älteren Transplantierten.
Ein zentrales Problem ist die Adhärenz. Komplizierte Dosierschemata, diätetische Vorschriften und Nebenwirkungen belasten die Jugendliche im Alltag stark und verschlechtern die Therapietreue. Am Beispiel des Morbus Wilson plädierte Prof. Bufler für vereinfachte Therapiekonzepte zur Verbesserung der Adhärenz. Registerdaten und kleinere Studien zeigen, dass eine medikamentöse Umstellung auf Einmalgaben bei stabil eingestellten Erkrankten funktionieren kann. Auch Verbote wie eine strikte kupferarme Ernährung seien bei Patientinnen und Patienten mit Morbus Wilson kritisch zu hinterfragen. Sind sie gut eingestellt, kann man diese Reglementierungen lockern, um den Betroffenen das Leben – und damit die Therapietreue – ein bisschen zu erleichtern.
Isolation, instabile Familiensituationen und Depressionen können die Krankheitsbewältigung erschweren. Prof. Bufler betonte deshalb die Notwendigkeit, psychologische und soziale Unterstützung systematisch einzubeziehen. „Soziale Arbeit ist wahrscheinlich das Allerwichtigste“, sagte er, und forderte strukturierte Transitionssprechstunden sowie verbindliche Abläufe mit klarer Kommunikation und Kontinuität aller Ansprechpartner.
Junge Menschen mit Zöliakie bleiben bei der Transition oft auf der Strecke
„Transition ist kein Termin, den man vergibt, es ist keine Telefonnummer, keine Visitenkarte, keine Google-Seite“, sagte Prof. Dr. Jan de Laffolie vom Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Auch er hob damit auf die Wichtigkeit eines geplanten, strukturierten Prozesses ab und beschrieb die Situation bei jungen Menschen mit Zöliakie: „Wir wissen, dass über 50 % der Jugendlichen mit Zöliakie nicht die Erwachsenennachsorge erreichen.“
Dabei ist gemäß der Leitlinien eine lebenslange Begleitung von Zöliakie-Betroffenen vorgesehen. Dazu gehört es, Symptome, Adhärenz und Serologie zu überprüfen, die Lebensqualität zu erfassen und assoziierte Begleiterkrankungen im Blick zu halten. In komplexeren Fällen kann es erforderlich sein, weiterführende Schritte einzuleiten, etwa eine Rebiopsie zur Einschätzung der Krankheitsaktivität. Durch Bestimmung von glutenimmunogenen Peptiden im Urin können Diätverstöße bei der glutenfreien Ernährung nachgewiesen werden.
Der Experte bedauert sehr, dass das Berliner Transitionsprogramm zwar für einige Indikationen wie CED, Epilepsie oder Psoriasisarthritis etabliert wurde – die Zöliakie jedoch nicht dabei ist.
Quelle: Kongressbericht Viszeralmedizin 2025