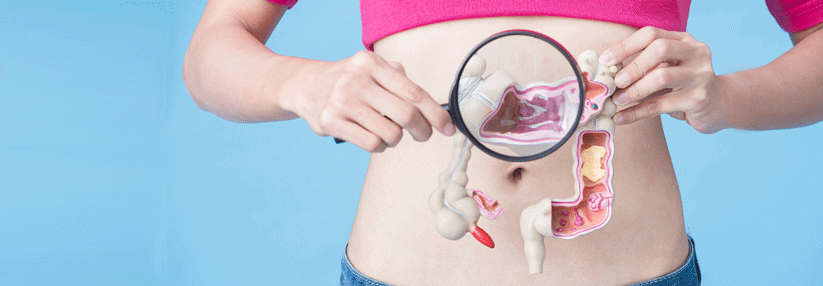
Leitlinien zur Kontrollkoloskopie bei CED Wie das erhöhte Darmkrebsrisiko bei CED endoskopisch überwacht wird
 Welche Kontrollintervalle senken das Darmkrebsrisiko bei CED? Neue britische Leitlinien geben klare Empfehlungen.
© KMPZZZ – stock.adobe.com
Welche Kontrollintervalle senken das Darmkrebsrisiko bei CED? Neue britische Leitlinien geben klare Empfehlungen.
© KMPZZZ – stock.adobe.com
Das Darmkrebsrisiko bleibt für Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen trotz effektiver Medikamente erhöht. Welche Betroffenen sollten engmaschiger koloskopiert werden und wie genau ist nach einem Dysplasienachweis vorzugehen? Die Britische Gesellschaft für Gastroenterologie hat hierzu eine neue Leitlinie herausgebracht.
Nach einer aktuellen Metaanalyse liegt das Risiko für Darmkrebs bei Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) um 40–70 % höher als das der Allgemeinbevölkerung. Je länger die Erkrankung andauert, desto höher steigt das kumulative Krebsrisiko. Das kolorektale Karzinom (CRC) weist eine um 40–50 % höhere Letalität auf als bei Betroffenen, die nicht an CED erkrankt sind.
Ein Cochrane-Review von fünf Beobachtungsstudien hat gezeigt, dass regelmäßige koloskopische Kontrollen die Krebsinzidenz insgesamt senken kann und dass der Anteil von kolorektalen Frühkarzinomen in Überwachungsgruppen höher und der Anteil fortgeschrittener Tumoren niedriger ist als in den nicht überwachten Gruppen.
Nach einer Koloskopie entwickelt sich bei Personen mit CED signifikant häufiger ein Kolorektalkarzinom als bei nicht an CED Erkrankten. Laut einer Metaanalyse lag die Dreijahresinzidenz bei 30,8 % versus 6,8 %. Bei Colitis ulcerosa ist die Krebsinzidenz nach Koloskopie signifikant höher als bei Morbus Crohn. Mehr als die Hälfte dieser nach Koloskopie entdeckten Karzinome lässt sich dadurch erklären, dass empfohlene Kontrollkoloskopien unnötig verzögert wurden.
Die erste koloskopische Kontrolle wird üblicherweise 8 Jahre nach Beginn der CED-Symptome empfohlen. Lediglich Personen mit einer Colitis in Zusammenhang mit einer primär sklerosierenden Cholangitis (PSC) sollten wegen ihres besonders hohen Krebsrisikos von Anfang an koloskopisch überwacht werden. Kein spezielles koloskopisches Screening brauchen wegen ihres relativ geringen Krebsrisikos Personen, deren CED sich nicht oberhalb des Rektums manifestiert.
Das weitere Vorgehen richtet sich nach dem endoskopischen Befund und dem individuellen Risiko. Eine fortbestehende schwere aktive Entzündung trotz optimierter medikamentöser Therapie bedeutet ein hohes Krebsrisiko. Hier sollte eine Kolektomie erwogen werden.
Den entzündeten Darm auf die Koloskopie vorbereiten
Die britische Leitlinie enthält Empfehlungen, wie bei Patientinnen und Patienten im Rahmen der Verlaufskontrolle die Darmvorbereitung für die Koloskiopie ausehen sollte. Demnach sollen Lösungen, die auf Polyethylenglykol (PEG) basieren, mit geringem Volumen (≤ 2 l) verwendet werden oder nicht PEG-basierte Präparationen. Letztere werden besser akzeptiert als hochvolumige PEG-Lösungen (4 l), bringen aber ein vergleichbares Ergebnis.
Eine jährliche endoskopische Überwachung wird empfohlen, wenn trotz medikamentöser Therapie eine mäßig aktive Entzündung fortbesteht oder wenn eine Dysplasie, PSC oder Kolonstriktur besteht (mittelhohes CRC-Risiko). Kontrollen alle drei Jahre werden empfohlen bei leichter fortbestehender Entzündung oder wenn aus anderen Gründen ein geringes CRC-Risiko besteht, z. B. bei Kolon-CED oder einem Verwandten ersten Grades mit kolorektalem Karzinom. Als bevorzugtes Verfahren in der CED-Überwachung wird die farbbasierte High-Definition-Chromoendoskopie empfohlen. Sie detektiert Dysplasien etwas besser als die High-Definition-Weißlichtendoskopie.
Konventionelle adenomatöse Dysplasien und nicht konventionelle colitisassoziierte Dysplasien sind manchmal schwer voneinander abzugrenzen. Deshalb sollte immer eine Zweitmeinung aus der Pathologie zur Beurteilung hinzugezogen werden. Dies gilt auch für die Unterscheidung zwischen sessilen serratierten Läsionen ohne Dysplasie (irrelevant) und serratierten Formen nicht konventioneller Dysplasien. Bei jeder Kontrolluntersuchung sollten auch Biopsien entnommen werden, um die Krankheitsaktivität zu beurteilen.
Nur Läsionen, die in entzündlich veränderter Mukosa entstanden sind, sind für die Leitlinienempfehlungen zum Umgang mit adenomatösen Läsionen relevant. Alle dysplastisch aussehenden Läsionen sollten en bloc reseziert werden. Größere nicht polypoide Läsionen benötigen ausgedehntere Verfahren wie Mukosaresektion oder submukosale Dissektion.
Nach kompletter Resektion der Dysplasie genügen bei polypoiden niedriggradigen Dysplasien < 2 cm jährliche Kontrollen über fünf Jahre. Bei höhergradigen Dysplasien oder solchen mit Risikomerkmalen (polypoid ≥ 2 cm, nicht polypoid, multifokal oder unvollständig en bloc reseziert) sollte die erste Kontrolle schon nach drei bis sechs Monaten stattfinden. Die Kontrollfrequenz kann zurückgestuft werden, wenn in fünf Jahren keine Dysplasierezidive aufgetreten sind und die Betroffenen keine Risikomerkmale aufweisen.
War eine Dysplasie nicht sichtbar und wurde nur durch Biopsie zufällig entdeckt, sollte die Koloskopie nach drei bis sechs Monaten von Untersuchenden mit Erfahrung wiederholt werden. Wird sie auch dabei nicht bestätigt, sollte die endoskopische Überwachung für fünf Jahre fortgesetzt werden. Wird sie allerdings bestätigt, ist eine Kolektomie der fortgesetzten Überwachung vorzuziehen.
Quelle: East JE et al. Gut 2025; doi: 10.1136/gutjnl-2025-335023




