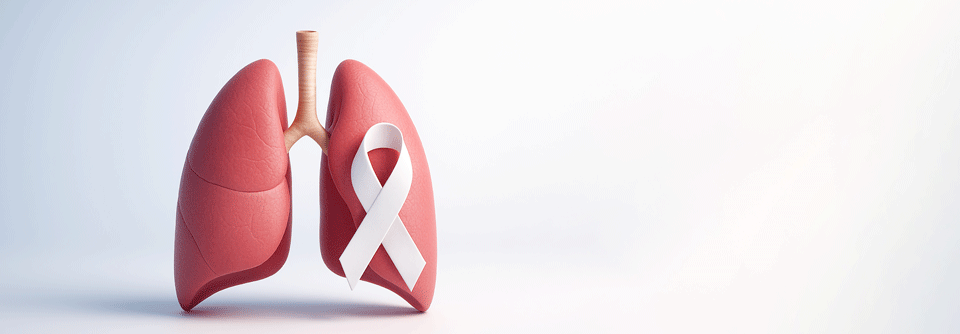Exposom - lebenslange Umweltwirkung Wie das Exposom Lungenkrankheiten beeinflusst
 Exposom, Asthma, COPD: Wie Umwelt und Lebensstil Lungenkrankheiten fördern – und welche Präventionsprojekte jetzt starten.
© ARSM D - stock.adobe.com
Exposom, Asthma, COPD: Wie Umwelt und Lebensstil Lungenkrankheiten fördern – und welche Präventionsprojekte jetzt starten.
© ARSM D - stock.adobe.com
Geht es um die Prävention von chronischen Lungenerkrankungen, muss man das gesamte Exposom berücksichtigen, das auf den Menschen Zeit seines Lebens und bereits davor einwirkt. In der Forschung ist interdisziplinäre Zusammenarbeit gefragt, zahlreiche Projekte stecken wortwörtlich schon bzw. noch in den Kinderschuhen.
Das Exposom umfasst bei chronischen Lungenerkrankungen alles, was auf die Lunge einwirkt – das ganze Leben lang und auch schon vor der Geburt, erläuterte Prof. Dr. Ane Johannessen, Umweltepidemiologin von der Universität Bergen. Dazu zählen generelle äußere Einflüsse wie Klima, Luftverschmutzung, gesellschaftliche Veränderungen oder Chemikalien. Spezifische externe Exposomfaktoren sind beispielsweise Ernährung, Wasserversorgung körperliche Aktivität und Verhalten. Dazu kommen Elemente des inneren Exposoms, beispielsweise oxidativer Stress, Inflammation, epigenetische Veränderungen, Stoffwechsel oder das individuelle Mikrobiom, erläuterte die Referentin.
Will man effektive Maßnahmen zur Früherkennung und Prävention von Erkrankungen sowie zur Vermeidung von Risikofaktoren weiterentwickeln, muss man die lebenslange Expositionsgeschichte mit allen äußeren und inneren nichtgenetischen Krankheitstreibern berücksichtigen. Das bisherige Studiendesign sieht aber anders aus: Im Mittelpunkt steht meist der Effekt einer bestimmten Exposition auf die Krankheitsentwicklung. Die Untersuchung multipler Einflüsse ist in Studien schwierig und erfordert neue Konzepte und die Kooperation einer großen Zahl von Fachdisziplinen. Noch steht die Exposomforschung ganz am Anfang, aber es gibt erste Ansätze mit großen Kohorten und in speziellen Exposomprojekten.
So untersuchte die Arbeitsgruppe von Prof. Johannessen beispielsweise, ob das Geschlecht des Ungeborenen in Bezug auf das Exposom in utero eine Rolle spielt beim späteren Auftreten von Giemen und Infektionen der unteren Atemwege. Insgesamt berücksichtigen die Forschenden 44 potenzielle Faktoren während der Schwangerschaft. Bei 18 fanden sie sowohl für Jungen als auch für Mädchen eine Assoziation mit dem untersuchten Endpunkt. Meist waren diese Zusammenhänge bei Mädchen ausgeprägter. Für Rußpartikelkonzentration, Grünflächen in der Umgebung sowie deren Größe ergab sich nur bei Mädchen eine signifikante Assoziation mit Giemen und unteren Atemwegsinfektionen in der Kindheit.
Die Einflüsse zu Lebzeiten inklusive der pränatalen Phase sind aber noch lange nicht alles. Epidemiologische Studien haben gezeigt, dass auch präkonzeptionelle Expositionen der Eltern Auswirkungen auf die Lungengesundheit der nachkommenden Generation haben.
Beispielsweise führt aktives Rauchen vor dem 15. Lebensjahr bei männlichen Jugendlichen zu einem erhöhten Allergie- und Asthmarisiko für deren spätere Kinder. Bei schon früh rauchenden Mädchen, die Mutter wurden, war das nicht der Fall.
In der EU laufen erste großangelegte Exposomprojekte unter anderem im Rahmen des European Human Exposome Network (EHEN), berichtete Prof. Johannessen. Dieses umfasst 126 Forschungsgruppen in 24 Ländern und wird mit 106 Millionen Euro von der Europäischen Kommission unterstützt. Eines der aktuell neun großen Projekte dieses Netzwerks ist EXPANSE. Exposombasiert sollen Maßnahmen entwickeln werden, um die Gesundheit in Städten und Ballungsgebieten zu verbessern. Geplant ist zudem der Aufbau eines Werkzeugkastens, aus dem sich künftige Vorhaben bedienen können. Im Rahmen des ERS-Kongresses kam erstmals das Netzwerk EXPLAIN-IT zusammen, das sich der internationalen und interdisziplinären Exposomforschung bei chronischen Lungenerkrankungen widmet, so die Referentin.
Die Exposomforschung kann ganz konkrete Folgen haben, berichtete Prof. Dr. Erol Gaillard von der Universitätsklinik für pädiatrische Pneumologie in Leicester und erläuterte das anhand eines Beispiels. Im Zuge des Klimawandels führt in Nordeuropa und Großbritannien eine höhere Niederschlagsmenge zu einer wachsenden Belastung durch Feuchtigkeit und Schimmel in Haushalten. Aus Finnland wird beispielsweise ein Anstieg der von Schimmel betroffenen Haushalte auf insgesamt 19 % berichtet. Einer weiteren Studie zufolge sind Innenräume mit Schimmel und Schimmelgeruch mit der Entwicklung eines Asthmas im Kindesalter assoziiert. Interessant ist auch, dass sich thermotolerante filamentöse Pilze häufiger im Sputum von Kindern mit akutem als mit chronischem Asthma nachweisen lassen. Die Sensibilisierung gegen thermotolerante Spezies von Aspergillus, Penicillium oder Candida geht bei Asthmakindern mit einer schlechterten Lungenfunktion und mehr steroidpflichtigen Asthmaanfällen einher, betonte Prof. Gaillard.
2020 starb ein Kind in der Nähe von Manchester, nachdem der Schimmel in seinem Zuhause lange nicht beseitigt worden war. Sein Vorname war Awaab. Seit Oktober 2025 gilt in Großbritannien jetzt das Awaab-Gesetz: Danach können Mieterinnen und Mieter die Eigentümerin oder den Eigentümer der Wohnung verklagen, wenn nicht innerhalb klar definierter Zeiträume Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit, Schimmel und anderen Gefahren im Haushalt vorgenommen werden.