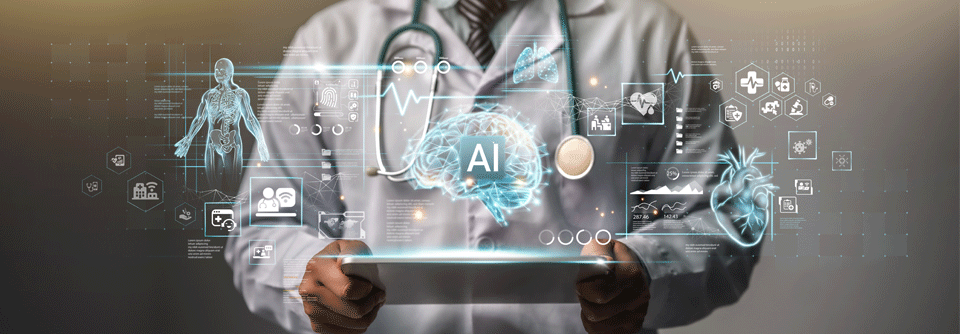Giemen, Rasseln, Knistern Wie digitale Stethoskope und KI-Algorithmen die Auskultation revolutionieren
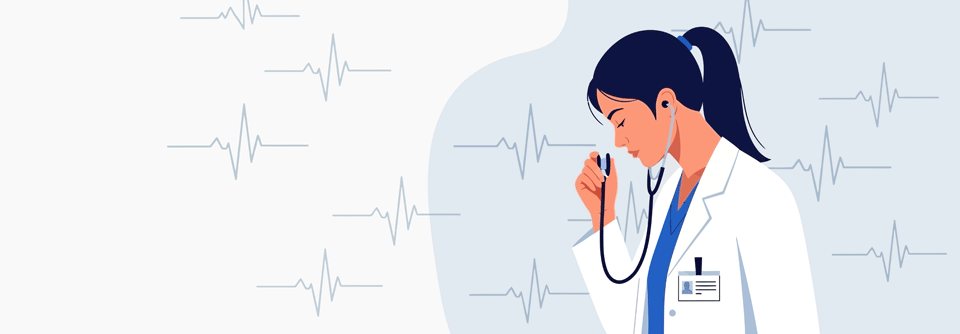 Die Interpretation des Gehörten lässt bei der Auskultation mit analogen Stethoskopen einigen Spielraum zu.
© MIRZATUL - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Die Interpretation des Gehörten lässt bei der Auskultation mit analogen Stethoskopen einigen Spielraum zu.
© MIRZATUL - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Um den Zustand der Atemwege zu beurteilen, legte man schon zur Zeit von Hippokrates das Ohr auf den Brustkorb eines kranken Menschen und versuchte, Geräusche zu hören und einzuordnen. Der französische Arzt René Laënnec baute 1816 das erste Stethoskop, seit dem frühen 19. Jahrhundert wurde ein Gerät genutzt, das den modernen analogen Stethoskopen grundsätzlich gleicht. Bis heute ist eine sorgfältige Auskultation der Lunge mit dem Stethoskop ein wichtiger Baustein der ärztlichen Untersuchung und wird von Patientinnen und Patienten auch erwartet, schreiben Prof. Dr. Anna Moberg von der Universität im schwedischen Linköping und ihr Team.
Terminologie bei Auskultation international uneinheitlich
Allerdings scheint das Vertrauen von Medizinerinnen und Mediziner in die Lungenauskultation nachzulassen – nicht zuletzt weil Terminologie und Klassifikation der Atemgeräusche international unterschiedlich gehandhabt werden und eine Vergleichbarkeit deshalb kaum möglich ist.
Zu den üblichen Limitationen der analogen Auskultation zählen die Qualität des benutzten Stethoskops, das Hörvermögen des Untersuchenden und seine Fähigkeit, die wahrgenommenen Geräusche korrekt zu kategorisieren. Zudem können Stridor, Rasseln, Knistern oder Giemen zwar typisch für bestimmte Lungenerkrankungen sein, aber Sensitivität und Spezifität dieser Befunde haben sich in der Diagnostik als eher niedrig erwiesen.
So kommt es, dass der GOLD-Report 2023 bereits keine Auskultationsbefunde bei der Früherkennung der COPD mehr enthält. Viele Kolleginnen und Kollegen stützen sich deshalb immer stärker auf moderne bildgebende Verfahren und Lungenfunktionstests – sofern erreichbar. Angesichts des mit diesen Verfahren verbundenen hohen Ressourcenverbrauchs und ggf. auch der Strahlenbelastung sollte die grundsätzlich hilfreiche Auskultation wieder an Bedeutung gewinnen, meint das Autorenteam. Dazu braucht es aber Geräte, die ein strukturiertes Vorgehen und eine objektive Interpretation ermöglichen.
Dies könnte mit digitalen Stethoskopen gelingen, die die Geräusche aufzeichnen, verstärken und über mobile Applikationen analysieren lassen. Objektiviert und kategorisiert werden die Ergebnisse durch die Anwendung von KI bzw. Methoden des maschinellen Lernens.
KI-gestützte Systeme punkten mit hoher Trefferquote
Studien zufolge „urteilen“ einige computergestützte diagnostische Verfahren bereits heute genauso gut wie Ärztinnen und Ärzte oder schneiden sogar besser ab. Laut einer kürzlich publizierten Analyse wies ein entsprechendes System z. B. bei der Diagnostik einer Lungenfibrose anhand der typischen Nebengeräusche eine höhere Sensitivität (91,7 % vs. 83,3 %) und Spezifität (59,3 % vs. 56,25 %) auf. Derartige Verfahren können also möglicherweise die Chance einer frühzeitigen Diagnose erhöhen und zugleich das Risiko von Überdiagnosen senken. Inzwischen wurden u. a. KI-Algorithmen entwickelt, die sich zur Diagnostik von Asthma bei Kindern und zum Monitoring von Atemgeräuschen eignen. Auch die Bestimmung der Atemphase, in der die Geräusche auftreten, ist mittlerweile dank KI-Algorithmen möglich.
Vor dem Hintergrund der erwartbaren raschen Weiterentwicklung der KI messen die Autorinnen und Autoren den digitalen Stethoskopen in Kombination mit KI größte Bedeutung zu – in der Ausbildung junger Ärztinnen und Ärzte, im Praxisalltag und beim Monitoring von chronisch kranken Personen im telemedizinischen Setting. Zu berücksichtigen ist allerdings eines: Die Güte von Deep-Learning-Modellen hängt entscheidend von der Qualität der zugrunde liegenden Daten ab, mit denen das System trainiert wurde. Ein Problem dabei ist die Empfindlichkeit gegenüber Störgeräuschen und Rauschen, ein weiteres die geringe Menge an Daten zu seltenen Erkrankungen.
Es müssen noch weit mehr Daten sowohl aus der Primärversorgung als auch der spezialisierten Behandlung von Patientinnen und Patienten zur Verfügung gestellt werden, appellieren die Forschenden. Dann werde die Qualität der Auskultation erheblich verbessert und damit ihre Rolle in der routinemäßigen klinischen Untersuchung wieder gestärkt.
Quelle: Moberg A et al. Expert Rev Respir Med 2025; 19: 879-885; doi: 10.1080/17476348.2025.2511223