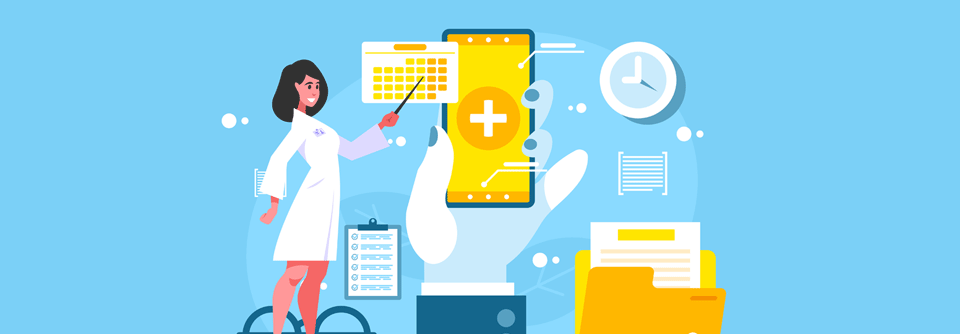Lymphome und Co. Wie Tumormikroumgebung und Darmmikrobiom CAR-T-Zell-Resistenzen fördern
 Die Diversität des Mikrobioms spielt auch bei der CAR-T-Zell-Therapie eine große Rolle und lässt sich durch eine faserreiche Ernährung fördern.
© ArtemisDiana - stock.adobe.com
Die Diversität des Mikrobioms spielt auch bei der CAR-T-Zell-Therapie eine große Rolle und lässt sich durch eine faserreiche Ernährung fördern.
© ArtemisDiana - stock.adobe.com
Knapp die Hälfte der Erkrankten mit diffus großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) kann mit CAR-T-Zellen geheilt werden. Allerdings kommt es häufig zu primären Resistenzen. Warum ist das so? Dr. Camille Bigenwald vom Institute Gustave Roussy in Paris und ihre Kolleg:innen gingen dieser Frage in verschiedenen Experimenten auf den Grund.1
Wie lässt sich die Effektivität von CAR-T-Zellen erhöhen?
Mit folgenden Techniken kann man potenziell die Wirksamkeit von CAR-T-Zellen steigern:
- CRISPR/Cas9: dient der präzisen genetischen Modifikation von CAR-T-Zellen; erhöht die Proliferation, Persistenz und Aktivierungskapazität
- Allogene CAR-T-Zellen von gesunden Spender:innen
In den meisten Fällen kam es zu primären Resistenzen
Eine Optimierung der CAR-T-Zellen ist laut Dr. Bigenwald nicht ausreichend, um die Wirksamkeit zu steigern. In diesem Zusammenhang wurde ihren Worten zufolge die Tumormikroumgebung (TME) „vernachlässigt“. Genau die untersuchten die Forscherin und ihr Team jetzt anhand von Proben, die sie von 94 DLBCL-Patient:innen unter CAR-T-Zell-Therapie gewannen: darunter Blut, Knochenmark, fäkales Material und Tumorbiopsien.
53 % hatten auf die CAR-T-Zell-Therapie angesprochen, 82 % waren mit Axicabtagen-Ciloleucel behandelt worden. Knapp die Hälfte (47 %) erlitt ein Rezidiv, das median nach 2,5 Monaten auftrat. „Die meisten hatten eine primäre Resistenz“, konstatierte die Referentin. Auf Basis von 80 Tumorbiopsien führten die Forschenden verschiedene Analysen durch, darunter Immunhistochemie, RNAscope, Flow-Zytometrie und Immunoassays.
Der Antigenescape ist meist nicht schuld
Die CAR-T-Zellen infiltrierten die Tumoren sowohl bei Patient:innen, die ansprachen, als auch in der Gruppe der Non-Responder. Während die B-Zellen bei den Respondern durch die CAR-T-Zell-Therapie schnell depletiert wurden, blieb eine Fraktion von B-Zellen in der Gruppe der Non-Responder bestehen. Es stellte sich heraus, dass bei den meisten Rezidiven die CD19-Expression erhalten geblieben war. „Ein Antigenverlust repräsentiert daher nicht den häufigsten Resistenzmechanismus“, resümierte Dr. Bigenwald.
Genetische Analysen wiesen darauf hin, dass die lokale Umgebung die Dysfunktionalität der CAR-T-Zellen antrieb. Darüber hinaus unterdrückten myeloide Faktoren die CAR-T-Zell-Aktivität. „Es scheint so, dass bereits früh nach der CAR-T-Injektion eine myeloide Zellpopulation existiert, die sich negativ auf die CAR-T-Zell-Funktionalität auswirkt“, erläuterte die Referentin. In der TME vor der Infusion fanden sich vermehrt CSFR+ und TREM2+ myeloide Zellen.
Die Tumormikroumgebung ist der Übeltäter
Einzelzell-RNA-Sequenzierungen, die vor der CAR-T-Infusion durchgeführt wurden, bestätigten den Verdacht, dass die TME eine wichtige Rolle spielt. Im Vergleich zu Patient:innen, die ansprachen, waren in myeloiden Zellen von Non-Respondern Signalwege hochreguliert, die mit Inflammation und Hypoxie einhergingen. In T-Zellen der Non-Responder fanden die Forschenden eine Hochregulierung von Signalwegen, die mit u. a. Zellproliferation und -aktivierung sowie mit der Apoptose assoziiert sind. Die frühe CAR-T-Zell-Dysfunktion werde daher sehr wahrscheinlich durch die TME angetrieben, resümierte Dr. Bigenwald.
Und was macht das Darmmikrobiom?
Das Darmmikrobiom spielt für die Funktionalität von CAR-T-Zellen ebenfalls eine große Rolle, erläuterte Prof. Dr. Christoph Stein-Thoeringer vom Universitätsklinikum Tübingen.2 Zusammen mit seinen Kolleg:innen suchte der Forscher nach Biomarkern im Mikrobiom, die ein Langzeitansprechen vorhersagen können.
Tatsächlich gingen verschiedene Bakterienstämme mit einem Ansprechen einher, darunter Bacteroides eggerthii, Ruminococcus lactaris und Akkermansia muciniphila. Allerdings funktionierte das Modell, das die Forschenden anwandten, nur bei Patient:innen ohne Antibiotikaexposition.
Antibiotika verkürzen OS nach CAR-T-Zell-Therapie
Werden Antibiotika vor der CAR-T-Zell-Infusion gegeben, so ist das mit einer vermehrten Progression und einem kürzeren Überleben assoziiert. Konkret stören die Medikamente die Alpha-Diversität des Mikrobioms, ebenso die taxonomische und funktionelle Zusammensetzung. Potenzielle Pathobionten werden durch die Antibiotikatherapie erhöht. Die Substanzen verändern auch das Serum- und Stuhl-Metabolom. Zum Beispiel reduzieren sie kurzkettige Fettsäuren.
Was bewirken „schlechte“ Bakterienstämme?
Bei rund 20-30 % der Patient:innen unter CAR-T-Zell-Therapie dominieren Enterokokken, hauptsächlich Enterococcus faecium. Heißt: Der Bakterienstamm macht die Hälfte des Mikrobioms aus. Die Dominanz geht mit einer schlechten Prognose einher und ist auch mit einer erhöhten Expression von Markern der CAR-T-Zell-Erschöpfung assoziiert, so Prof. Stein-Thoeringer. In vitro induzierte Enterococcus den Verlust der CAR-T-Zell-Funktion nach repetitiver CAR-T-Zell-Stimulation. Bestimmte Gene dienten dabei als Virulenzfaktoren und trieben die Immunantwort des Wirts an.
Was bewirkt die Ernährung?
Durch eine Ernährungsumstellung lässt sich das Mikrobiom positiv beeinflussen – zum Beispiel, indem man mehr auf faserreiche Kost setzt. So sind wasserlösliche und -unlösliche Fasern, absorbierbare Oligosaccharide und Cellulose offenbar mit der Alpha-Diversität assoziiert.
Achtung: Cellulose ist nicht immer gut!
Bei Patient:innen unter CAR-T-Zell-Therapie, die keine Antibiotika erhielten, konnte eine Ernährung mit viel Cellulose das progressionsfreie Überleben verlängern. Doch Vorsicht: Wurden die Betroffenen mit Antibiotika behandelt, so kehrte sich das Bild um. Hier schnitten diejenigen, die viel Cellulose aßen, schlechter ab als jene mit einer cellulosearmen Ernährung – und zwar sowohl hinsichtlich PFS als auch OS.
Prof. Stein-Thoeringer hob abschließend die Bedeutung der „Microbiome Stewardship“ hervor. Es gelte, Schäden am Mikrobiom zu verhindern oder dessen Fitness und metabolischen Output zu verbessern.
Quellen:
1. Bigenwald C. ESMO Congress 2025; Vortrag „Cellular and cytokine tumour microenvironment“
2. Stein-Thoeringer C. ESMO Congress 2025; Vortrag „The impact of the microbiome“