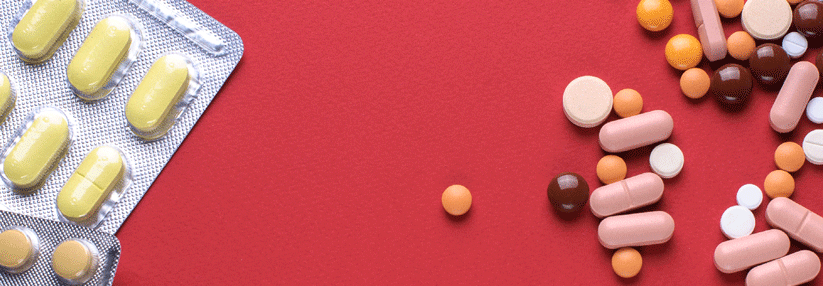Antidepressiva im Praxistest Antidepressiva: Selten nötig, oft falsch verschrieben
 Statt bei leichten Depressionen vorschnell Pharmaka zu rezeptieren, sollte man auf alternative Methoden setzen.
© irissca – stock.adobe.com
Statt bei leichten Depressionen vorschnell Pharmaka zu rezeptieren, sollte man auf alternative Methoden setzen.
© irissca – stock.adobe.com
Beim Einsatz von Antidepressiva und den Folgen ihres Absetzens gehen die Meinungen nach wie vor weit auseinander. In einer Sache sind sich die Fachleute allerdings einig.
Kein Zweifel besteht, dass Antidepressiva bei leichten Depressionen allenfalls marginal wirksam sind. Dennoch werden sie in dieser Indikation und sogar in subklinischen Fällen sehr häufig verschrieben, bemängelt der klinische Psychologe Prof. Dr. Michael Hengartner von der Kalaidos Fachhochschule in Zürich. Bei mittelschweren und schweren Depressionen könne man mit einer im Durchschnitt schwachen Effektivität der Wirkstoffe rechnen. Nach seiner Aussage gilt: je stärker die Depression, desto größer der Nutzen der Medikamente.
Auch Prof. Dr. Tom Bschor, Psychiater am Universitätsklinikum Dresden und Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, kritisiert die therapeutische Praxis. Die Zahl der Antidepressivaverordnungen habe sich in den letzten 30 Jahren versechsfacht. Behandelt würden vor allem leichte und mittelschwere Depressionen. Tatsächlich ist die Indikation laut Nationaler VersorgungsLeitlinie aber nur bei schweren Depressionen eindeutig gegeben. Es sei ein Irrtum zu glauben, das Ausstellen eines Rezepts könne Probleme schnell und einfach lösen, sagt Prof. Bschor.
In der Hausarzt-, aber auch in der psychiatrischen Praxis solle man vermehrt auf „Kardinalmaßnahmen“ setzen – auch um die Wartezeit bis zur Psychotherapie zu überbrücken. Dazu gehören u. a. Aufklärung, Strukturierung des Tages, Einplanen positiver Aktivitäten, Regulierung des Tag-Nacht-Rhythmus, Sonnenlichtexposition und körperliche Aktivität. „Das ist erstaunlich gut wirksam“, betont der Kollege. Außerdem verweist er auf verschiedene DiGA.
Betroffene auch über Absetzphänomene aufklären
Hat man sich für eine medikamentöse Therapie entschieden, ist es sinnvoll, nicht nur das Nebenwirkungsprofil der verschiedenen Antidepressiva zu berücksichtigen, sondern auch ihr Potenzial für schwere Entzugssymptome. Zudem sollte man die Patientinnen und Patienten über mögliche Absetzphänomene aufklären, fordert PD Dr. Jonathan Henssler, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité – Universitätsmedizin Berlin. Zwar hätten die meisten antidepressiv Behandelten keine Probleme nach dem Therapiestopp, manche entwickeln aber erhebliche Beschwerden.
Bei 31 % der Menschen, die die Einnahme eines Antidepressivums beenden, kommt es zu mindestens einem Absetzsymptom. Meist sind die Entzugszeichen mild ausgeprägt und verschwinden nach etwa zwei Wochen wieder, erklärt Prof. Bschor. Allerdings: Laut einer Metaanalyse, an der der Kollege beteiligt war, entwickeln auch 17 % derjenigen, die eine Placeboeinnahme stoppen, Beschwerden.
Wie lange man ein Antidepressivum genommen haben muss, um (gravierende) Absetzsymptome hervorzurufen, ist unter den Experten strittig. Prof. Bschor geht von „mindestens vier, vielleicht sogar acht Wochen“ aus. Nach Aussage von Prof. Hengartner nimmt die Inzidenz von Entzugssymptomen erst ab etwa drei Monaten Therapiedauer deutlich zu. Mit schweren und persistierenden Symptomen sei in der Regel erst ab ca. sechs Monaten zu rechnen. Und Dr. Henssler meint, man könne derzeit nicht sicher beurteilen, ob sehr lange Einnahmezeiträume von z. B. mehreren Jahren das Risiko für häufigere und ausgeprägtere Entzugssymptome erhöhen.
Einig sind sich die Kollegen dagegen in der Einschätzung, dass Antidepressiva zwar eine körperliche Abhängigkeit, aber keine Sucht verursachen. Letztere impliziert laut Prof. Hengartner ein Verhaltensmuster mit unkontrollierter Substanzeinnahme, ständigem Verlangen und Vernachlässigung anderer Interessen. Dieses Verhaltensmuster zeigt sich unter einer Antidepressivatherapie nicht.
Pressemitteilung – Science Media Center