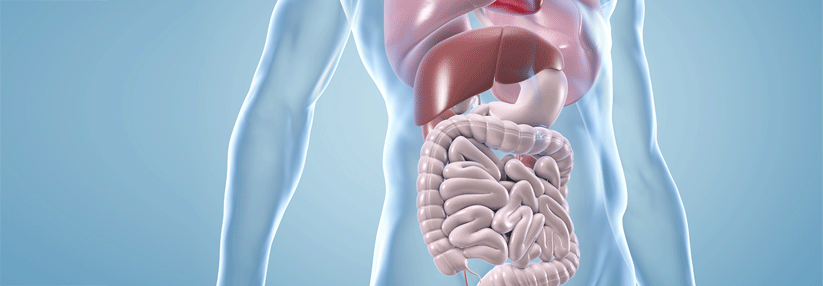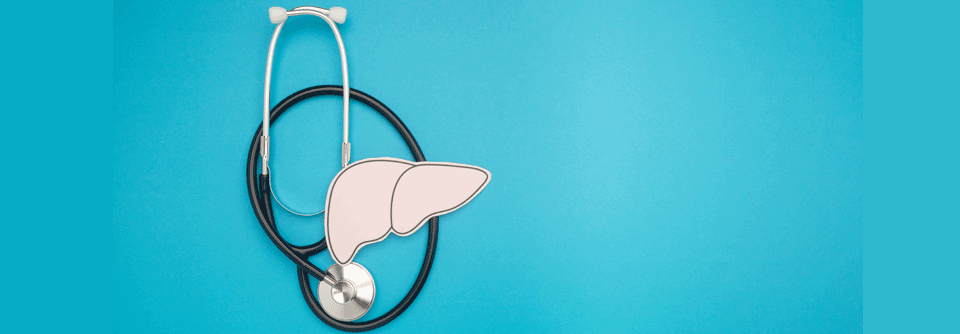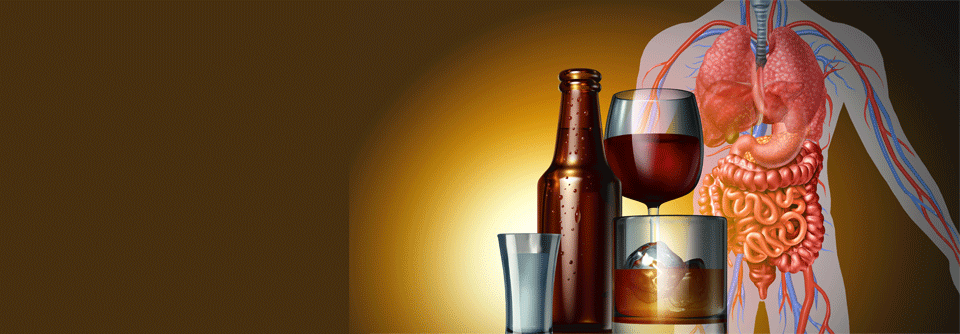
Jeder Schluck zählt Auch bei der metabolisch bedingten Fettleber zur Alkoholabstinenz raten
 Schon geringe Mengen Ethanol gelten bei der metabolischen Fettleber (MASLD) als ein Progressionsfaktor.
© tatiana_davidova – stock.adobe.com
Schon geringe Mengen Ethanol gelten bei der metabolischen Fettleber (MASLD) als ein Progressionsfaktor.
© tatiana_davidova – stock.adobe.com
Lässt sich bei einer Patientin oder einem Patienten eine Lebersteatose nachweisen, sollte nach metabolischen Risikofaktoren und Alkoholkonsum gefragt werden. Liegt neben der Fettleber mindestens eine weitere Komorbidität wie Adipositas, Diabetes, Hypertonie, Hypertriglyzeridämie oder Hypercholesterinämie vor, handelt es sich um eine metabolische-Dysfunktion‑assoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD). Die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten setzt zudem eine Grenze des Alkoholkonsums bei 10 g (Frauen) bzw. 20 g (Männer) Ethanol pro Tag.
Auch wenn Menschen mit MASLD weniger Alkohol konsumieren als jene mit einer MetALD* oder einer alkoholassoziierten Lebererkrankung – Alkohol gilt insgesamt als unterschätzter Cofaktor bei den steatotischen Lebererkrankungen, betonte Prof. Dr. Frank Tacke von der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Schon kleine Mengen stellen einen relevanten Progressionsfaktor dar und spielen eine Rolle für die Fibroseentwicklung. Man sollte Betroffenen daher zur Alkoholabstinenz raten, so der Experte. Als verlässlicher Marker für den Konsum dient der Nachweis von Phosphatidylethanol.
Ein wesentlicher Indikator für die Prognose bei MASLD ist das Ausmaß der Leberfibrose. Da sich eine Leberbiopsie nicht als schnell verfügbarer und wiederholbarer Routinetest eignet, empfehlen verschiedene europäische Fachgesellschaften ein sogenanntes Case Finding, das sich auch primärärztlich umsetzen lässt.
Die Basis bildet der Fibrose-4(FIB4)-Index, gefolgt von einer Elastografie. Der serumbasierte Score berechnet sich aus den Routineparametern Aspartat-Aminotransferase, Thrombozytenzahl und Alanin-Aminotransferase sowie dem Alter. Zwar sind andere Scores mitunter genauer, aber auch komplizierter, merkte Prof. Tacke an.
Schrittweise Personen mit hohem Risiko herausfiltern
Setzt man solche nichtinvasiven Verfahren allerdings unselektiv ein, dann steigt auch die Zahl der falsch-positiven Befunde, so der Experte. Die Fachgesellschaften empfehlen ein stufenweises Vorgehen zur Risikostratifizierung. Das heißt, der FIB4-Index sollte in der primärärztlichen Versorgung zunächst nur erhoben werden, wenn ein Typ-2-Diabetes, eine Adipositas mit mindestens einem weiteren kardiometabolischen Risikofaktor oder persistierende erhöhte Leberwerte vorliegen. Der Wert entscheidet über das weitere Handeln:
- Bei einem Score < 1,3 bedarf es keiner besonderen Maßnahmen außer den allgemeinen Lebensstilempfehlungen; der Test sollte alle paar Jahre wiederholt werden.
- Bei einem Wert > 2,67 sollten Primärärztinnen und -ärzte an eine Spezialistin oder einen Spezialisten überweisen.
- Im Falle eines Indexes von 1,3–2,67 bzw. 1,3–2,0 bei Menschen im Alter von über 65 Jahren und einer Lebersteifigkeit ≥ 8 kPa ist ebenfalls eine Überweisung an ein spezialisiertes Team angeraten.
- Liegt die Lebersteifigkeit < 8 kPa sollte man die Behandlung der Begleiterkrankungen intensivieren und nach einem Jahr bei weiterhin erhöhtem FIB4-Score an eine Fachärztin oder Facharzt überweisen.
Besteht eine relevante Fibrose, gilt es zudem an das Screening auf hepatozelluläre Karzinome zu denken. Im Falle eines Fibrosestadiums F4 bzw. einer Leberzirrhose ist laut Leitlinie eine halbjährliche Sonografie angezeigt. Dasselbe gilt für Patientinnen und Patienten mit einer hochgradigen Fibrose (F3), sofern weitere Risikofaktoren vorliegen wie ein lang bestehender Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas, hohes Alter, sehr hoher FIB4-Score oder eine Lebersteifigkeit > 10 kPa. Fehlen solche Risikofaktoren oder ist der Fibrosegrad geringer, braucht es kein Screening.
Die Abgrenzung zwischen einer hochgradigen Fibrose (F3) und der Zirrhose (F4) gestaltet sich oft schwierig, erklärte der Experte. Genetische Scores könnten helfen, dass Karzinomrisiko besser einzuschätzen, dafür seien aber umfangreiche Tests nötig. Zudem ist auch die Ultraschalluntersuchung insbesondere bei Personen mit Adipositas schwierig. In der europäischen Leitlinie wird in solchen Fällen zur MRT als Alternative geraten. Auch ein kombiniertes Screening mit einem Wechsel zwischen halbjährlichem Ultraschall und jährlicher MRT könnte die Früherkennung bei Hochrisikopatientinnen und -patienten verbessern, so Prof. Tacke.
Gewicht muss sinken, bevor sich die Leber erholen kann
Die Basis der Therapie bilden Lebensstiländerungen, insbesondere mit dem Ziel der Gewichtsreduktion durch Kalorienrestriktion, mediterrane Ernährung und körperliche Aktivität. Denn eine relevante Verbesserung der Steatohepatitis und Fibrose ist bei Patientinnen und Patienten mit Übergewicht oder Adipositas erst ab einer Gewichtsreduktion von mindestens 7–10 % zu erwarten. Doch auch bei normalgewichtigen Personen zeigt sich häufig eine Fettfehlverteilung und ein hoher Anteil an viszeralem Fett. In solchen Fällen ist eine moderate Gewichtsreduktion von 3–5 % empfohlen.
Mit Tirzepatid und Semaglutid hat man mittlerweile hochpotente Medikamente zur Adipositastherapie zur Hand, mit denen man auch eine Gewichtsreduktion von 10 % erreichen kann, so der Referent. In Studien zeigten sich Semaglutid sowie die dualen Glukagon/GLP1-Rezeptoragonisten Tirzepatid und Survodutid vielversprechend zur Behandlung der Steatohepatitis und der Fibrose. Eine Zulassungserweiterung für Semaglutid wurde bereits beantragt. In einer Phase-2a-Studie führte die Therapie mit dem Dreifach-Agonisten Retatrutid zu einer deutlichen Reduktion des Leberfettgehalts sowie zu einer Gewichtsabnahme von bis zu 25 % – ein Effekt, der dem einer bariatrischen Operation nahekommt, betonte Prof. Tacke.
Die Subgruppen der metabolische-Dysfunktion-assoziierten steatotischen Lebererkrankung
Eine MASLD kann sehr unterschiedliche Verlaufsformen haben, erklärte Prof. Tacke. Es handelt sich nicht um eine einheitliche Erkrankung, sondern um ein heterogenes Spektrum mit verschiedenen Pathomechanismen. Forschende aus Frankreich identifizierten beispielsweise zwei Subtypen – einen kardiometabolischen und einen leberspezifischen. Die Subgruppen unterschieden sich sowohl in ihrem biologischen Profil als auch in der klinischen Progression.
So zeigten beide zwar einen ähnlichen Verlauf hinsichtlich hepatischer Komplikationen, doch bei der kardiometabolischen Subgruppe lag das Risiko für einen Typ-2-Diabetes oder schwerwiegende unerwünschte kardiale Ereignisse deutlich höher. Die Erkenntnisse aus der Studie bieten die Chance für personalisierte Therapiestrategien und verbesserte Risikostratifizierung, so der Referent. Daten aus einer bislang unveröffentlichten Studie zeigten zudem, dass bei Menschen des Leber-Subtyps eine geringere Gewichtsreduktion ausreichte, um einen positiven Effekt auf die leberassoziierten Outcomes zu erreichen.
Die bariatrische Chirurgie sollte man bei Patientinnen und Patienten mit entsprechender Indikation in Betracht ziehen. Denn aus Langzeitbeobachtungen geht hervor, dass nach einem solchen Eingriff leberassoziierte Komplikationen wie Zirrhose, hepatozelluläres Karzinom und Dekompensation seltener auftreten als bei einer konservativen Behandlung. Obacht gilt allerdings bei Vorliegen der Leberzirrhose, da es nach der Adipositaschirurgie zu einer Dekompensation kommen kann.
Für die Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis (MASH) gab es bislang keine spezifische Therapie. Doch im Juni 2025 hat der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA eine bedingte Zulassung für den Thyroidhormonrezeptor-Agonisten Resmetirom empfohlen. Die Therapie mit dem Medikament sollte bei Erwachsenen mit nichtzirrotischer MASH und einem Fibrosestadium F2 bis F3 erwogen werden.
Neue Substanzen, die sich auch bei einer MASH mit Leberzirrhose einsetzen lassen könnten, sind derzeit in der Entwicklung: So führten Analoga des Fibroblasten-Wachstumsfaktors 21 in entsprechenden Untersuchungen zu einer deutlichen Verbesserung der Fibrose bei bestehender Leberzirrhose. Und das gab es bislang noch nicht, betonte Prof. Tacke.
*metabolische-Dysfunktion-assoziierte steatotische Lebererkrankung mit erhöhtem Alkoholgebrauch
Quelle: Kongressbericht 14. Hepatologie-Update-Seminar