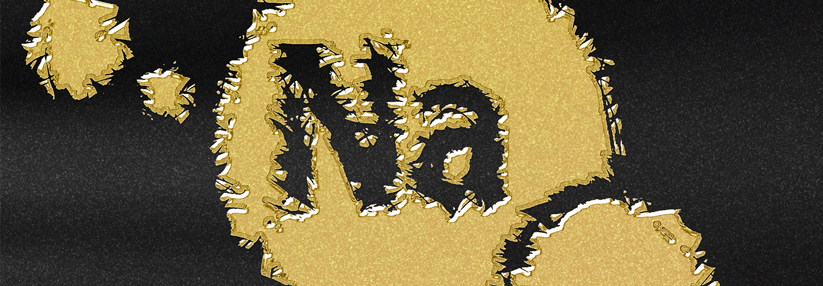Hyponatriämie „Brüsseler Champagner“ gegen Hyponatriämie
 In der Notaufnahme sind bei etwa 25 % der Betroffenen mit Hyponatriämie Thiaziddiuretika oder eine Hypovolämie die Ursache für die Elektrolytstörung
© thingamajiggs - stock.adobe.com
In der Notaufnahme sind bei etwa 25 % der Betroffenen mit Hyponatriämie Thiaziddiuretika oder eine Hypovolämie die Ursache für die Elektrolytstörung
© thingamajiggs - stock.adobe.com
In der Notaufnahme sind bei etwa 25 % der Betroffenen mit Hyponatriämie Thiaziddiuretika oder eine Hypovolämie die Ursache für die Elektrolytstörung, berichtete Prof. Dr. Matthias Girndt von der Inneren Medizin II der Universitätsklinik Halle-Wittenberg. Auch das Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion ist mit 22 % ein weit verbreiteter Auslöser, bei schwerer Hyponatriämie sogar noch häufiger als der Volumenmangel.
Wenig Wissen zur Wirkung hypotonischer Flüssigkeiten
Die Behandlung einer Hyponatriämie erfolgt oft nicht leitliniengerecht. Eine anonyme Befragung anhand von Fallvignetten bei Notärztinnen und Notärzten in Dänemark ergab, dass häufig falsche Infusionstherapien gewählt wurden. 25 % der Befragten hätten demnach eine hypotone Flüssigkeit bei Patientinnen und Patienten mit Hyponatriämie eingesetzt. Auch bei den Wissensfragen zum Einfluss hypotonischer Flüssigkeiten auf das Plasmanatrium von akut Kranken antworteten viele falsch.
Klinisch wird eine Hyponatriämie als asymptomatisch, moderat (Übelkeit, Verwirrtheit, Kopfschmerz) oder schwer (Erbrechen, Herz-Kreislauf-Symptome, Somnolenz, Krampfanfall, Koma) eingestuft. Asymptomatisch Betroffene zeigen aber häufig auf der Gehplatte eine starke Auslenkung der Korrekturbewegung und damit ein erhöhtes Sturzrisiko. Sie sind also keineswegs immer asymptomatisch, betonte Prof. Girndt und sagte, auch eine asymptomatische Hyponatriämie sei relevant. Biochemisch unterscheidet man nach dem Serumnatrium eine milde (130–135 mmol/l), moderate (125–129 mmol/l) und schwere Hyponatriämie (< 125 mmol/l).
Bei milder bis moderater Hyponatriämie mit Hypovolämie sollte immer der Volumenstatus ausgeglichen werden. Bei Hyponatriämie und Euvolämie liegt meist eine SIADH vor, z. B. im Rahmen von Malignomen, Infektionen oder einem Morbus Addison. Therapieoptionen sind eine Flüssigkeitsrestriktion, Tolvaptan (7,5 mg/d), Harnstoff (15 g/d) oder SGLT2-Inhibitoren (25 mg/d) zur Verstärkung der Wasserausscheidung.
Bei Hyponatriämie mit Hypervolämie sollte anhand des Natriums im Urin eine renale und eine nicht-renale Ursache unterschieden werden. Liegt eine renale Ursache vor, wird mit Flüssigkeitsretention und – bei einer glomerulären Filtrationsrate (GFR) > 30 – Tolvaptan behandelt. Bei einer nicht-renalen Ursache (Herzinsuffizienz? Leberinsuffizienz?) kommen zusätzlich auch Harnstoff und SGLT2-Inhibitoren zum Einsatz.
Das Rezept für „Brüsseler Champagner“
- 10 g Harnstoff
- 2 g Natriumhydrogenkarbonat
- 1,5 g Zitronensäure
- 200 mg Saccharose
- 50–100 ml Wasser
Von Tolvaptan habe man sich viel versprochen, berichtete Prof. Girndt. Es sei aber wahrscheinlich nicht wesentlich besser als die Flüssigkeitsrestriktion und biete keinen Überlebensvorteil. Er brach eine Lanze für kostengünstigere Optionen als erste Option. Die Flüssigkeitsrestriktion ist bei 50–70 % der Patientinnen und Patienten wirksam. Auch oraler Harnstoff ist effektiv und kann eingesetzt werden, wenn keine Niereninsuffizienz vorliegt. Um den Geschmack erträglich zu machen, wurde „Brüsseler Champagner“ kreiert (siehe Kasten).
Intravenös substituieren und Natrium ggf. wieder senken
Bei schwerer Hyponatriämie reichen oben genannte Maßnahmen nicht aus. Die Betroffenen bekommen deshalb 150 ml 3%ige NaCl-Lösung über 20 Minuten infundiert. Nach Kontrolle des Serumnatriums wird die Infusion wiederholt, bis das Natrium auf 4–6 mmol/l angestiegen ist. Bei über 6 mmol/l sollte die Gabe von Desmopressin und Glukoselösung erwogen werden, um das Serumnatrium wieder zu senken.
Quelle: Kongressbericht der DGIM