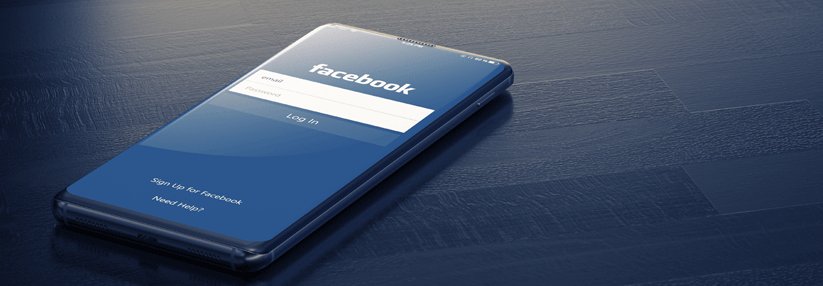
Like statt Leitlinie? Chancen und Risiken ärztlicher Aufklärung im Netz
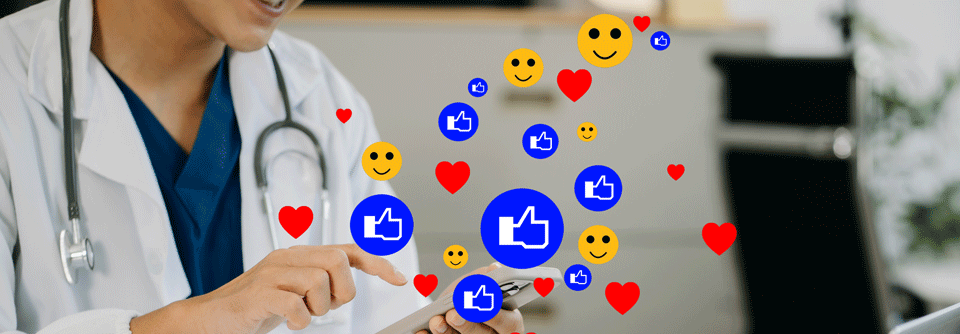 Immer mehr Ärzt*innen und andere Gesundheitsfachkräfte kommunizieren über Instagram, TikTok oder YouTube mit einer breiten Öffentlichkeit.
© NINENII - stock.adobe.com
Immer mehr Ärzt*innen und andere Gesundheitsfachkräfte kommunizieren über Instagram, TikTok oder YouTube mit einer breiten Öffentlichkeit.
© NINENII - stock.adobe.com
Während den meisten vor allem niederschwellige Gesundheitsaufklärung am Herzen liegt, verfolgen andere handfeste Geschäftsinteressen.
Wer in den sozialen Medien unterwegs ist und sich für Kindergesundheit interessiert, stößt über kurz oder lang auf den Kanal @handfussmund. Hier geben die Kinderärzte Dr. Nibras Naami vom Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke und PD Dr. Florian Babor von der Universitätsklinik Düsseldorf in kurzen Videos Tipps zur gesunden Ernährung von Kindern, informieren über Diagnostik und Therapie bei verschiedenen Krankheitsbildern und erklären, was in diversen kindermedizinischen Notfallsituationen zu tun ist. Für Eltern, die sich ausführlicher informieren möchten, nehmen die beiden einmal wöchentlich einen etwa einstündigen Podcast zu konkreten kindermedizinischen Fragestellungen auf.
Ihr Konzept geht auf: Den beiden folgen mittlerweile über 324.000 Menschen auf Instagram, knapp 230.000 Follower zählt ihr Kanal auf TikTok. „Ich habe im klinischen Alltag immer schon gern erklärt, das ist ja auch unser tägliches Brot in der Kindermedizin“, beschreibt Dr. Naami seine Motivation. „Diese kommunikative Ebene finde ich extrem spannend – nicht zuletzt, weil der Therapieerfolg ja auch stark davon abhängt. Wenn ich gut erkläre, wird die Therapie eher umgesetzt, als wenn viele Fragen offenbleiben.“
DDG Medienpreis 2024 für Instagram-Reel
Diese Form der Aufklärung in Sachen Kindergesundheit kommt nicht nur bei seinen Followern gut an. Auch die Jury des DDG Medienpreises konnte „Hand, Fuß, Mund“ überzeugen: Im November 2024 wurde Dr. Naami im Rahmen der Diabetes Herbsttagung für ein im Juli 2024 gepostetes Instagram-Reel ausgezeichnet. Darin erklärt der Kinderarzt in verständlicher Sprache und mit anschaulichem Bild- und Videomaterial, was Typ-1-Diabetes ist und auf welche Warnsignale Eltern achten sollten, damit es im Zusammenhang mit der Manifestation nicht zu einer lebensbedrohlichen Ketoazidose kommt.
Es war das erste Mal, dass die DDG ein Instagram-Video ausgezeichnet hat – für Dr. Naami ein Zeichen, dass die Fachgesellschaft mit der Zeit geht und soziale Medien als Informations- und Aufklärungsplattformen anerkennt. Er hält es für notwendig, dass auch Ärzt*innen dort präsent sind, schließlich nutzen immer mehr Menschen diese Medien auch in medizinischen Fragen als Informationsquelle. „Angesichts der großen Nachfrage sollte es dort ein gutes Angebot geben. Wir sollten also dafür sorgen, dass die Menschen auch in den sozialen Medien einen sicheren Hafen mit verlässlichen Informationen ansteuern können.“ Niederschwellig erreichbar und kostenlos, denn „medizinische Information sollte nicht hinter einer Paywall sein“, findet er.
Vertrauenswürdige Social-Media-Kanäle
Kanäle aus dem Bereich Diabetes, die Diabetesteams empfehlen können, sind z. B. die Kanäle der DDG (@ddg_diabetesgesellschaft), des Diabetes-Informationsportals Diabinfo (@diabinfo), von der Organisation diabetesDE (@deutschediabeteshilfe) und dem Diabetes-Anker (@diabetes_anker).
Ein weiterer bekannter „Medfluencer“ ist der Solinger Hausarzt Sebastian Alsleben, der auf @deinhausarzt auf Instagram postet und auch häufig auf @medicaltribune_de aktiv ist. Sowohl er als auch die beiden Ärzte von @handfussmund stellen außerdem unrichtige medizinische Behauptungen anderer Influencer richtig und nehmen gehypte medizinische Produkte, Nahrungsergänzungsmittel etc. kritisch unter die Lupe.
Einen der Gründe für den großen Informationsbedarf sieht Dr. Naami im überall herrschenden Zeitmangel in Praxen und Kliniken: „Es gibt Kollegen, die nach der Schicht in einem Zimmer Gespräche mit Eltern führen, weil in der Sprechstunde keine Zeit dafür war“, beschreibt er den Alltag in der Kinderklinik.
So entstand zunächst die Idee, in einem Podcast ausführlich über die Themen zu sprechen und die erklärenden Gespräche auf diese Weise mehr Menschen zugänglich zu machen. Für Menschen, die nicht gern lange Podcasts hören, produzieren Dr. Babor und er zweiminütige Videos und teilen sie via Social Media. „Ich weiß, dass viele Kollegen gern auf unseren Podcast oder Instagram-Kanal verweisen, wenn Eltern mehr wissen wollen“, erzählt er.
rotz ihres Bekanntheitsgrads auf Instagram und TikTok verstehen sich die beiden Kinderärzte aber nicht als „Medfluencer“. „Ich finde den Begriff nicht so gelungen, denn er kommt von Influencer. Und damit wird jemand bezeichnet, der ein kommerzielles Interesse verfolgt und gegenüber seiner Community Produkte anpreist“, erklärt Dr. Naami. „Wir nennen uns lieber „Meducator“, denn wir versuchen aufzuklären und nutzen dafür eben digitale Wege.“ Als Ärzte sind sie der ärztlichen Berufsordnung verpflichtet – und die gebietet Zurückhaltung bei produktbezogenen Aussagen (siehe Kasten).
„Medfluencer“ ohne ärztliche Approbation hingegen unterliegen nicht den Auflagen der Berufsordnung. Sie preisen im Rahmen von Werbepartnerschaften häufig auch konkrete Produkte oder Therapien an, die einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten. Unter ihnen finden sich auch Medizinstudierende, die sich mithilfe ihrer Social-Media-Reichweite ihr Studium finanzieren – oder in Wahrheit längst mehr Zeit mit Influencer-Aufträgen als im Hörsaal ihrer Medizinischen Fakultät verbringen.
Kritisch zu sehen: Werbepartnerschaften
Die beiden Kinderärzte hingegen lehnen die meisten Angebote für Werbekooperationen ab, mit denen auf „Medfluencer“ spezialisierte Agenturen oder Unternehmen an sie herantreten. „Wir bieten aber Content-Kooperationen zu bestimmten Themen an“, erklärt Dr. Naami. Das kann z. B. ein sachlich aufklärender Beitrag zum Thema Sonnenschutz bei Kindern sein. Selbst wenn darin keine Produkte genannt werden, entsteht für das kooperierende Unternehmen ein Mehrwert, denn es kann das Video auch auf seinen eigenen Kanälen verbreiten.
Die Einkünfte aus solchen bezahlten Partnerschaften stecken die beiden Meducators in „Hand, Fuß, Mund”: „Wir bezahlen damit beispielsweise jemanden, der unsere Videos professionell schneidet und bearbeitet“, berichtet Dr. Naami, der pro Woche etwa 10 bis 15 Stunden in den Aufklärungskanal investiert. „Meine Klinik unterstützt mich zwar und sieht einen Mehrwert in dieser Arbeit. Aber im Wesentlichen muss ich das irgendwie nebenbei stemmen.“
DDG warnt vor unseriösen Social-Media-Kanälen
Ein klassisches Geschäftsmodell steckt also nicht hinter @handfussmund – vielmehr der Wunsch, Menschen aufzuklären und sie zur Selbsthilfe zu ermächtigen. Genau dieser Aspekt ist auch DDG Mediensprecher Professor Dr. Baptist Gallwitz wichtig. Seiner Erfahrung nach trauen sich viele Menschen nämlich nicht, im Gespräch mit Ärzt*innen all ihre Fragen zu stellen. „Das hat eine hierarchische Komponente, denn noch nicht alle Ärzte kommunizieren auf Augenhöhe mit ihren Patienten.“
Umso wichtiger sei es, dass man bei der Suche im Netz auf seriöse Informationen stößt. „Leider ist es sehr unterschiedlich, wie viel Medienkompetenz die Menschen mitbringen“, weiß Prof. Gallwitz. Nicht alle seien in der Lage, Beiträge in den sozialen Medien kritisch zu hinterfragen – etwa, ob „Medfluencer“ ihre Aussage mit mindestens einer wissenschaftlichen Quelle belegen können.
In knapp bemessenen Videos ist es zudem nicht immer möglich, komplexe Sachverhalte ausgewogen darzustellen. „Insbesondere auf TikTok sind die Beiträge in der Regel sehr kurz. Außerdem ist der Algorithmus darauf ausgelegt, Nutzern immer wieder ähnliche Beiträge einzuspielen“, mahnt der Diabetologe. „Auf diese Weise werden Menschen in ihrer Haltung bestätigt, die ihnen durch unseriöse Kanäle erst eingeimpft wurde.“
Welchen Effekt diese Form der Beeinflussung haben kann, lässt sich an der Art der Anfragen ablesen, die bei der DDG Pressestelle eintrudeln. In den vergangenen Monaten betrafen sie z. B. häufig die Glukosemessung bei Stoffwechselgesunden, die seit einer Weile von vielen „Medfluencern“ propagiert wird. „In den sozialen Medien gibt es das Narrativ, dass sogar einmalige Blutzuckerspitzen sehr gefährlich sein können“, berichtet Prof. Gallwitz. Dies könne in den Praxen zu ermüdenden Diskussionen über die Auswahl von Lebensmitteln oder Getränken führen. „So etwas führt zu Furcht oder Fehlverhalten im Umgang mit ganz natürlichen Dingen. Im extremen Fall kann daraus sogar eine Essstörung entstehen.“
Seinen Kolleg*innen rät er daher, sich bewusst zu machen, dass viele Menschen ihre Informationen zum Teil auch aus fragwürdigen Quellen in den sozialen Medien beziehen. „Man sollte daher Patienten proaktiv darauf aufmerksam machen, worum es bei manchen dieser Kanäle eigentlich geht. Und natürlich sollte man ihnen auch seriöse Informationsquellen im Netz empfehlen.“
BÄK-Regeln für Ärzt*innen in den sozialen Medien
In der Handreichung „Ärztinnen und Ärzte in den sozialen Medien“ der Bundesärztekammer werden Regeln formuliert, erklärt und Beispiele genannt. „Ärztliche Schweigepflicht beachten“, „keine berufswidrige Werbung auf sozialen Medien“, „Zurückhaltung bei berufsbezogenen Aussagen“ sind Beispiele für die insgesamt zwölf Regeln.
Handreichung der Bundesärztekammer – Ärztinnen und Ärzte in sozialen Medien (2023)
bundesaerztekammer.
de/themen/aerzte/digitalisierung/ aerzte-und-social-media




