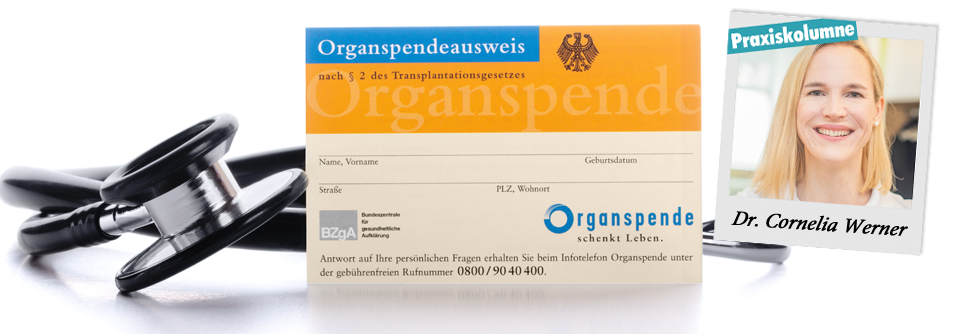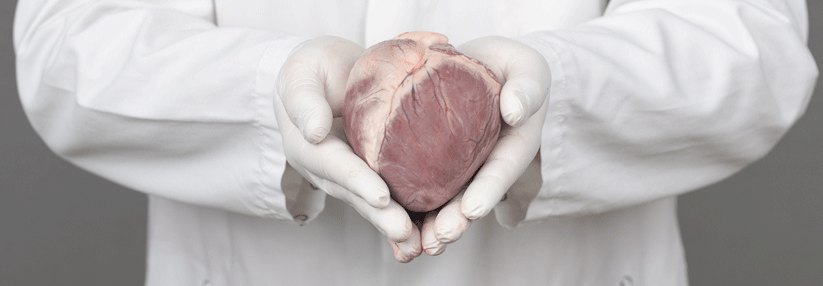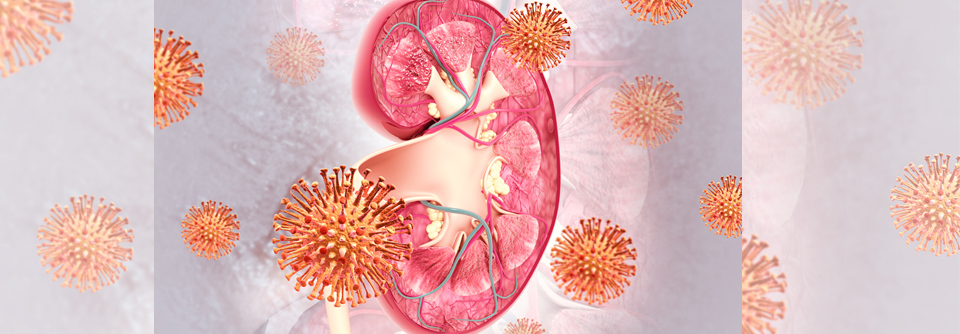Dialyse und Urlaub Der Blick ins Ausland: Nierenersatztherapie in Griechenland
 Die jährliche Inzidenz von Nierenversagen im Endstadium (ESRD) in Griechenland ist doppelt so hoch wie im europäischen Durchschnitt, die Zahl der Organtransplantationen ist gering.
© Lichtwolke99 - stock.adobe.com
Die jährliche Inzidenz von Nierenversagen im Endstadium (ESRD) in Griechenland ist doppelt so hoch wie im europäischen Durchschnitt, die Zahl der Organtransplantationen ist gering.
© Lichtwolke99 - stock.adobe.com
Dialysepflichtig? Urlaub in Griechenland? Kein Problem
Griechenland – Trauminseln und -strände mit komfortablen Ferienanlagen inkl. Dialysepraxen, gutes Essen und geschichtsträchtige Sehenswürdigkeiten, kurzum das Urlaubsland für viele Deutsche schlechthin. Auch Menschen mit einer chronischen Nierenerkrankung (CKD), die auf die Dialyse angewiesen sind, können es sich dort während eines Ferienaufenthaltes gut gehen lassen. Doch das, was sie dort in Bezug auf die Betreuung von Patienten mit Bedarf für eine Nierenersatztherapie sehen und erleben, spiegelt nur einen Teil der Gesundheitsversorgung in Griechenland wider.
Die jährliche Inzidenz von Nierenversagen im Endstadium (ESRD) in Griechenland ist doppelt so hoch wie im europäischen Durchschnitt, die Zahl der Organtransplantationen ist gering. Und obwohl die Prävalenz und die Inzidenz für CKD und ESRD dort sehr hoch sind, bestehen bei den Rahmenbedingungen für die etwas mehr als 10 Millionen Einwohner Griechenlands in Bezug auf Dialyse und Nierentransplantation im Vergleich zu anderen Ländern z. T. noch erhebliche Defizite. „Entsprechende aktuelle Daten verdanken wir der Hellenic Society of Nephrology (vgl. DGfN), in der griechische Nephrologinnen und Nephrologen organisiert sind“, berichtete Dr. Panagiota Zgoura, Chefärztin der Klinik für Innere Medizin am St. Anna-Hospital Herne, im Rahmen der 33. Erfurter Dialysefachtagung im Mai 2025 in der traditionellen Sitzung „Der Blick ins Ausland“.
Die Realität für griechische Patienten
Dass Griechenland in vielen Belangen zurückliegt, habe verschiedene Gründe, erläuterte Dr. Zgoura. Da ist einerseits die Zergliederung der Landfläche durch mehrere Inseln, was Auswirkungen auf die Verteilung von Krankenhäusern und Dialysepraxen sowie auf die Wegstrecken der Patienten hat. Des Weiteren hat das Land eine hohe Urbanisierungsrate von 80,7 %, ein etwas anders als hierzulande funktionierendes Gesundheitssystem und knapp 28 Millionen Touristen pro Jahr [1]. Viele Dialysezentren sind hauptsächlich der Küste entlang zu finden, genau dort, wo die ausländischen Patienten Urlaub machen wollen, während Griechen mit einer chronischen Nierenerkrankung lange Wege und z. T. Fährfahrten zurücklegen müssen, um dreimal in der Woche in eine Dialysepraxis zu kommen. Das medizinische Personal sei wenig geschult und habe das Thema Organspende kaum „auf dem Schirm“. Zudem habe die Finanzkrise 2008 dem Land heftig zugesetzt und Griechenland in vielen Bereichen zurückgeworfen, hob Zgoura hervor. Ein weiterer Aspekt sei die Risikokonstellation für ESRD in der griechischen Bevölkerung.
Risikofaktoren, die zur Niereninsuffizienz führen
Das betrifft zum einen das hohe Durchschnittsalter der Bevölkerung in Griechenland. Mehr als 22,3 % sind über 65 Jahre alt (in Europa 20,6 %), und das bei einer hohen Lebenserwartung von 81,2 Jahren, was die Problemlage zukünftig noch verschlimmern könnte. Auch die Adipositas (BMI> 25 kg/m2) gelte als zunehmender Risikofaktor. 57,2 % der Bevölkerung sind adipös, und die griechischen Kinder sind schon seit mehreren Jahren hintereinander Europas übergewichtigster Nachwuchs. Hinzu kommt, dass mit 24,9 % der Anteil der Raucher in Griechenland überdurchschnittlich hoch ist (Europa 16,5 %). Der Alkoholkonsum pro Kopf pro Jahr mit 6,7 l erscheint zwar relativ niedrig (Europa 8,7 l) [2, 3, 4], habe aber noch Verbesserungspotenzial, erklärte die Referentin.
Eine für griechische Verhältnisse große Studie mit 1.500 Teilnehmenden [5], an der immerhin neun nephrologische Zentren beteiligt waren, zeigte wenig überraschend, dass als einer der Hauptrisikofaktoren Diabetes auch hier führend ist, gefolgt von Hypertonie und hypertensiver Nierenerkrankung. Die Patienten hatten einen durchschnittlichen BMI von 28,8 kg/m2. Außerdem haben die Autoren festgestellt, dass Personen mit erhöhtem Risiko in der Regel viel zu spät nephrologisch vorgestellt werden. Die meisten erst ab ungefähr einem Kreatininwert von 2,2 mg/dl, entsprechend mit einer eGFR< 40 ml/min/1,73 m², sodass es kaum mehr Möglichkeiten gibt ESDR zu verhindern. Womit Dr. Zgoura nahtlos überleiten konnte zu einem Aspekt, bei dem sich Griechenland deutlich unterscheidet von anderen europäischen Ländern wie z. B. Deutschland.
Das Gesundheitssystem in Griechenland
Es ist organisiert als stark zentralisiertes, gemischtes Gesundheitssystemmodell mit einem gesetzlichen Krankenversicherer (Nationale Organisation für die Erbringung von Gesundheitsdiensten (EOPYY), verwaltet von der elektronischen Sozialversicherungsanstalt (e-EFKA)) und nur einigen wenigen Privatversicherungen, seit es mit der Finanzkrise zur Insolvenz vieler Krankenkassen kam. Die Gesundheitsausgaben pro Kopf betragen laut einer Analyse von Charlotte Johnston-Webber et al. 1.603 Euro (EU 3.523 Euro) [6]. Der Anteil des BIP an den Gesundheitsleistungen beträgt 7,8 % im Vergleich zur EU, in der er sich auf 9,9 % beläuft. Die finanzielle Belastung der Patienten für einzelne Leistungen ist sehr hoch. Vieles müssen die Patienten selbst zahlen, das heißt z. B. auch für das Labor. Dieses schickt die Werte zu, und dann muss sich der Patient selbst kümmern, zu einem Nephrologen gehen oder eben auch nicht. Und während im europäischen Durchschnitt nur 1,7 % der Bevölkerung einen ungedeckten Bedarf an medizinischer Versorgung anmelden, sind es in Griechenland 8,7 %. Ein weiteres Problem sieht Dr. Zgoura in der Tatsache, dass es weder eine Kostenübernahme für Primärprävention, noch Screeningprogramme im Sinne der Sekundärprävention gibt.
Insgesamt sei das Vertrauen der Bevölkerung in das Gesundheitssystem sehr niedrig und habe vor allem mit der Finanzkrise noch mehr verloren. Es werde in letzter Zeit zwar wieder stärker, aber wachse nur sehr langsam.
Dialyse in Griechenland
Der größte Teil der insgesamt rund 15.500 dialysepflichtigen Patienten in Griechenland wird zurzeit mit Hämodialyse (HD) behandelt. Die Peritonealdialyse (PD) wird weniger angewendet (ca. 6 %). HD und PD beanspruchen zusammen etwa 2 % der kompletten Gesundheitskosten. Dieser Anteil werde steigen, befürchten Experten, denn CKD steigt im Ranking der Todesursachen kontinuierlich an. 2040 werde CKD G5 als Todesursache bereits auf Rang 5 stehen. Die Frage wird dann sein, prognostiziert Zgoura, wie die wenigen finanziellen Ressourcen zukünftig verteilt werden. Wer hat die größte Lobby? Wie die Versorgung dann aussieht, wird auch davon abhängen, wie viele Dialysezentren zukünftig in der Fläche vorhanden sein werden.
Die gute Nachricht ist, die Entwicklung verläuft nach Überwindung einiger Probleme, die die Finanzkrise mit sich brachte, seit 2013 bislang positiv. Nachdem es zunächst hauptsächlich Dialysezentren in (staatlichen) Krankenhäusern unter oft „chaotischen Bedingungen“ gab (man musste oft auf einen Dialyseslot und eine Dialysemaschine warten oder die Dialyse fiel einfach mal ganz aus, Dialysemaschinen wurden teilweise über Land, Wasser und Luftwege hin- und hergefahren [7]), bieten nach der Gründung des ersten Zentrums in privater Trägerschaft auf der Ferieninsel Kreta im Jahr 2000 mittlerweile auch einige weitere private Träger die Leistung in küstenfernen Gebieten an. Damit haben sich insgesamt die Bedingungen und die Versorgungsqualität für Dialysepatienten schon etwas verbessert.
Nierentransplantation in Griechenland
In Griechenland begann die Geschichte der Transplantationsmedizin bereits 1968, als erstmalig eine Nierentransplantation erfolgreich durchgeführt wurde. Es folgten verschiedene Programme, Anfang der 1990er Jahre auch für Leber, Herz und Pankreas. Im Jahre 2001 wurde die Greece National Transplant Organisation (NTO), bekannt als Hellenic Transplant Organization (EOM), gegründet. Sie habe jedoch bis heute nur eine beratende Funktion und kann keine Reformen durchsetzen, erklärte Zgoura. Aber man hat Regeln und Gesetzes-Vorschläge erarbeitet, z. B. bzgl. der Hirntoddiagnostik, und unternahm auch Anstrengungen zur Gewinnung und Schulung von Transplantations-Koordinatoren. 2008 gab es sogar ein Lungentransplantationsprogramm. Die Zahl der Organspender und -Empfänger stieg auf 28 Transplantationen pro eine Million Einwohner (per Nach anfänglich ambitionierten Ansätzen Ende der 1960er Jahre ist Griechenland bei Betrachtung vieler vergleichbarer europäischer Länder weit zurückgefallen und hat auch in den letzten zehn Jahren kaum Fortschritte erzielt, konstatieren die von der Onassis Foundation mit oben genannter Analyse zur Situation der Organspende und Transplantation beauftragten Autoren der London School of Economics and Political Science [6]. Zurzeit gibt es landesweit fünf Transplantationszentren für rund 3.000 Nierentransplantierte. Ein sechstes steht schon seit längerem „in den Startlöchern“, ist aber noch nicht in Betrieb. Die Zahl der Transplantate liegt aktuell bei 18,6 pmp, mit einem hohen Anteil an Lebendnierenspenden.
Die von Charlotte Johnston-Webber et al. vorgelegte Analyse hat wesentliche politische Defizite aufgezeigt, die sich auf die Organspende und -transplantation in Griechenland auswirken [6]. Die Autoren leiten daraus Empfehlungen für Veränderungen zur Verbesserung der Situation in Griechenland ab. Deren Umsetzung könnte Griechenlands Fortschritte in Richtung einer mit erfolgreichen europäischen Transplantationssystemen vergleichbaren Leistung beschleunigen.
Dr. Zgoura erläuterte einige der möglichen Reformansätze:
- Einführung einer soft-opt-out policy
Widerspruchslösung mit Mitspracherecht der Angehörigen des potenziellen Spenders, wie sie in anderen Ländern sehr erfolgreich praktiziert wird.
- Erweiterung der Spendemöglichkeiten
Neben dem Ausbau des cross-over-Programms sowie der Verwendung altruistischer Spenden könnte z. B. die Organspende von Kindern erlaubt werden. Genauere Bestimmungen in der Hirntoddiagnostik würden mehr Sicherheit geben. Und die Organspende nach Herz-Kreislauf-Stillstand (Controlled Donation after Circulatory Determination of Death (cDCDD)) könnte die Spenderzahlen erhöhen. Diese Option werde europaweit, auch in Deutschland, in der Politik und auch in Fachkreisen zunehmend diskutiert und z. T. befürwortet. Bislang ist in Griechenland eine Organentnahme nur nach Hirntod erlaubt. Das Thema wird die Transplantationsmediziner, Ethiker und viele weitere an den Prozessen Beteiligte nicht nur in Griechenland noch weiter beschäftigen.
- Mehr Maßnahmen zur Einführung und Förderung von Primär-, Sekundär-, Tertiärprävention
Dabei geht es vor allem um Aufklärung und Schulung der Bevölkerung zum Umgang mit Nikotin, Alkohol, Adipositas, Diabetes und Hypertonie; die Etablierung von Screeningprogrammen für Hochrisikopatienten; eine bessere Ausbildung und Schulung des medizinischen Personals inklusive mehr Trainingsprogramme für Ärzt:innen und Pflegekräfte.
- Stärkung und Fortsetzung der begonnenen Restrukturierung der NTO
Hier sei die Durchsetzung der Unabhängigkeit vom jeweils amtierenden politischen Regime essenziell. Zudem braucht die Organisation eine bessere Finanzierung, um sie personell stärker zu besetzen und den Job attraktiver zu machen.
- Einführung eines einheitlichen IT-Systems
Dies würde es ermöglichen, für mehr Transparenz bezüglich der Wartelisten bei Eurotransplant zu sorgen, ein Lebendspenderegister zu etablieren und eine bessere internationale Kooperation zu ermöglichen.
- Erhöhung der Erstattungskosten für Transplantations-Aktivitäten
Es gibt zwar DRG für TX-Kosten, aber bei der Lebendspende wird z. B. erst ab dann bezahlt, wenn ein Organ transplantiert wird. Die Explantation wird nicht finanziert, die Organentnahme muss der Spender zum großen Teil selbst zahlen. Die Lebendspender werden nach TX nicht untersucht und auch bei längeren Krankenhausaufenthalten müssen sie nach der Spende viele Kosten mittragen.
- Einrichtung von mehr Transplantationszentren
Die Rekrutierung von Ärzt:innen und eine Erweiterung der medizinischen Expertise in allen beteiligten Disziplinen − Nephrologie, Gefäßchirurgie, Chirurgie, Urologie, Intensivmedizin sowie mehr Nachbetreuungskapazität und mehr Ressourcen in HLA-Laboren sind erforderlich. Diese Labore gibt es bisher nur in den TX-Zentren, ebenso wie Koordinatoren, zur Zeit sind es sieben an der Zahl, die alle im Headquarter der NTO in Athen angesiedelt sind. Und es kommt schon manchmal vor, dass keiner von ihnen verfügbar ist, dann wird das TX-Programm kurzerhand ausgesetzt.
- Verbesserung der Qualitätsstandards
Es sollten klare Regelungen zur Genehmigung und Lizensierung von TX-Zentren getroffen werden, Audits und Überprüfungen durch die NTO stattfinden und nationalweite Standards für die Listung und Standards für die Nachsorge erarbeitet werden.
- Intensivierung der Forschung
Seit 1985 wurden lediglich 12 Originalstudien bzgl. TX aus Griechenland publiziert. Es gibt auch keine regelmäßige und rege Teilnahme an internationalen Studien. Die wenigen bestehenden TX-Organisationen müssen mehr involviert werden und eine stärker beratende Funktion erhalten.
Quintessenz und Ausblick
Bei hoher Prävalenz und Inzidenz für CKD und ESRD hat Griechenland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bei der Versorgung seiner Bürger mit Bedarf an nephrologischen Leistungen sowohl im Bereich der Prävention als auch bei der Dialyse und in der Transplantationsmedizin erheblichen Nachholbedarf. Nach anfänglich guter Entwicklung seit Ende der 1960er Jahre hatte das Land viele Rückschläge zu verkraften, insbesondere war die Finanzkrise 2008 mit vielen Problemen für das Gesundheitssystem verbunden. Um die strukturellen und teilweise auch systemisch bedingten Defizite aufzuholen, müssten zur Verhinderung von ESRD zukünftig mehr Geld und Expertise in die Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention investiert sowie Schulungsprogramme zur Transplantationsmedizin ausgeweitet und ggf. die Transplantationsregeln reformiert werden.
Die Problematik und der Bedarf insbesondere in Bezug auf die Organtransplantation sind von vielen Stakeholdern durchaus erkannt und es gibt erste Erfolge auf dem Weg zur Verbesserung der Situation. So berichtete der griechische Newsletter TO BHMA im Mai dieses Jahres, dass Griechenland laut Gesundheitsminister Adonis Georgiadis im Jahr 2024 einen Anstieg der Organspender um 60 % verzeichnet und sich die Zahl der Transplantationen mehr als verdoppelt habe. Der Newsletter führte aus: „Im Rahmen einer Veranstaltung ‚Gemeinsam stärken wir die Kette des Lebens‘ im Onasseio Cardiac Surgery Center sagte Georgiadis, man steuere 2025 auf einen neuen Rekord zu, und er betonte die inzwischen anhaltenden Fortschritte des Landes bei der Organspende. Georgiadis kündigte an, dass IDIKA – das Sozialversicherungs- und Verschreibungssystem des Landes – SMS-Nachrichten versenden wird, um die Bürger zur Registrierung im Nationalen Register für Organ und Gewebespender aufzufordern. Im Jahr 2024 wurden rekordverdächtige 367 Transplantationen durchgeführt, darunter Nieren-, Leber-, Herz- und Lungentransplantationen. Bis Mitte April dieses Jahres wurden insgesamt 103 Transplantationen durchgeführt. Georgiadis fügte hinzu, dass die Sensibilisierung für Organspenden und die Erhöhung der Spenderquote in Griechenland oberste Priorität für die Regierung hätten. Zu den Maßnahmen in diesem Zusammenhang gehören die Stärkung der Nationalen Transplantationsorganisation (NTO) durch acht neue Koordinatoren, der Aufbau eines Netzwerks lokaler Koordinatoren in Spenderkrankenhäusern, die Schulung von medizinischem Personal und die Sensibilisierung durch öffentliche Kampagnen.“ Es scheint auch hier einen Aufschwung zu geben.
Resümee
Der Blick in andere Länder kann die Beurteilung der Lage im eigenen Land, bei aller Kritik auch an unserem Umgang mit der Organspende und der Transplantationsproblematik in Deutschland, relativieren. Abschließend kommentierte Tagungsleiter Dr. Haufe vom HELIOS Klinikum Erfurt: „Es ist erstaunlich, wie groß die Unterschiede innerhalb der westeuropäischen Community noch sind. Die Ausführungen von Frau Dr. Zgoura haben gezeigt, dass wir unseren Patienten in Deutschland ein relativ luxuriöses Setting anbieten können.“ Dennoch gibt es immer und überall Verbesserungspotenzial.
Quelle: Vortrag von Dr. Panagiota Zgoura im Rahmen der 33. Erfurter Dialysefachtagung am 08. Mai 2025
Literatur
1. Statista 25
2. OECD/European Observatory on Health Systems and Policies 2021
3. OECD Health at the Glance 2021 (Gesundheit auf einen Blick)
4. ERA-EDTA registry Annual Report 2019
5. Sombolos K et al. Multicenter Epidemiological Study to Assess the Population of CKD Patients in Greece: Results from the PRESTAR Study 20214
6. Johnston-Webber C et al. The National Organ Donation and Transplantation Program in Greece: Gap Analysis and Recommendations for Change. Transpl Int. 2023 May 25;36:11013. doi: 10.3389/ti.2023.11013. PMID: 37305340; PMCID: PMC10249496
7. www.capita.gr/me-apopsi/i-alitheia-gia-tin-aimokatharsi-stin-elleda