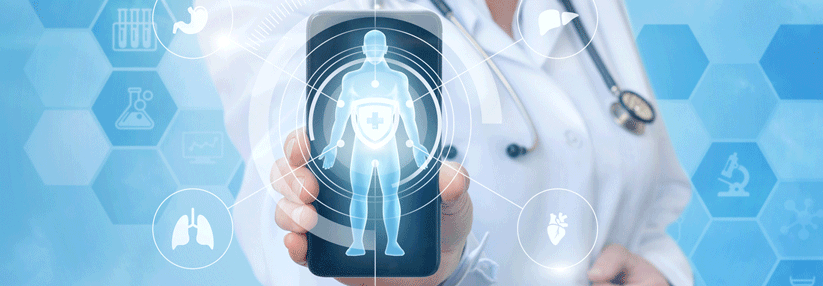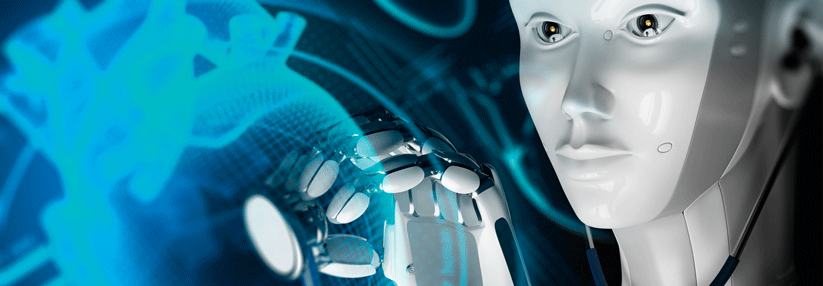Digitale Gesundheit: Vor welchen Herausforderungen stehen wir wirklich?
 Die Zukunft im Blick: Die Digitalisierung muss auch im Gesundheitswesen endlich entschlossener umgesetzt werden.
© iStock/roberthyrons
Die Zukunft im Blick: Die Digitalisierung muss auch im Gesundheitswesen endlich entschlossener umgesetzt werden.
© iStock/roberthyrons
Vor allem stehen mangelnder politischer Wille und das starre Selbstverwaltungs-System einer entschlossenen Umsetzung in Deutschland entgegen, sagte Manuel Ickrath, Unternehmensberater und Sprecher der Kommission Digitalisierung in seinem Eingangsvortrag beim Digitalisierungssymposium der DDG Frühjahrstagung am Freitagnachmittag. Es gibt keinen flächendeckenden Breitbandausbau, ohne den z.B. im ländlichen Raum keine Telemedizin möglich ist. Es gibt keine einheitlichen Datenstandards und auch der Datenschutz wird eher als willkommene Verhinderungsstrategie missbraucht. Hinzu kommt die Lähmung der Selbstverwaltung, die seit Jahren erfolgreich die elektronische Patientenakte verhindert und bis dato keine Vergütung für digitale Versorgungsangebote in den Leistungskatalog aufgenommen hat.
Bei alledem läuft uns die Zeit davon, denn Apple, Amazon und Google werden nicht warten auf die langsamen Entscheidungswege der deutschen Politik, sondern bereiten längst Gesundheitsangebote für den User (= Patient) vor. Ickrath beendete seinen Vortrag mit einem passenden Spruch von Rilke: Die Zukunft zeigt sich uns, lange bevor sie eintritt! Die DDG arbeitet bereits daran, wie digitale Technologie uns helfen kann, die Versorgung der Patienten mit Diabetes zu verbessern. Details zur „elektronischen Diabetesakte DDG (eDA DDG)” stellte der Past Präsident der DDG Professor Dr. Dirk Müller- Wieland in seinem Vortrag zwar nicht vor, er gab jedoch einen guten Überblick über den strukturellen und umfassenden Ansatz der eDA DDG.
Danach sollen sämtliche Gesundheitsdaten eines individuellen Patienten in eine Datenplattform zusammenfließen, Daten aus dem niedergelassenen Bereich ebenso wie aus der Klinik, perspektivisch auch aus den CGM- und CSII-Daten sowie aus den Apps, die von den Patienten genutzt werden. Es soll Eingangsportale sowohl für Patienten als auch für Leistungserbringer geben und über eine Hotline können sich Patienten informieren oder beraten lassen. Die Vielzahl der Daten (Big Data) ermöglicht ein umfassendes Datenregister, das für Diabetesforschung und Prävention genutzt werden kann.
Aktuell werden modulare Versorgungskonzepte mit den entsprechenden AGs entwickelt, z.B. zum diabetischen Fußsyndrom, zu Diabetes und Schwangerschaft und zu Adipositas, um die Trennung zwischen den Sektoren aufzuheben, prozess- und ergebnisorientiertes Qualitätsmanagement zu ermöglichen und besondere Expertisen der Schwerpunkt-Diabetologie sichtbar zu machen. Ein neu gegründetes Team, bestehend aus Professor Dr. Bernd Kulzer, Bad Mergentheim, Professor Dr. Baptist Gallwitz, Tübingen, Professor Dr. Dirk Müller-Wieland, Aachen, sowie zwei Ärzten aus der Charité Berlin, Dr. Matthias Rose und Dr. Andrea Figura, kümmern sich aktuell um die Patientenperspektiven für die eDA.
Anforderungen für eine elektronische Patientenakte
Damit übergab Prof. Müller-Wieland das Wort an Dr. Rose, der mit seiner Präsentation tiefer in die Struktur der geplanten eDA der DDG einführte und die Stakeholder für „Patient Reported Health Assessments“ (Therapiebeurteilung aus Patientensicht) benannte: Neben Ärzten und anderen Gesundheitsdienstleistern sind dies Akteure des Gesundheitswesens, die Industrie und die Wissenschaft. Aus alledem ergibt sich ein Bündel von Anforderungen an eine eDA: Neben der Integrationsfähigkeit der Daten in den klinischen Alltag der Ärzte und Kliniken müssen diese nutzbar sein sowohl für transnationale Register/Surveys als auch für die regulatorischen Institutionen und nicht zuletzt für die Forschung und Wissenschaft.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist ein modulares System geplant, eine Art Toolbox, die neben allgemeinen Informationen zum einzelnen Patienten auch individuelle Gewohnheiten (Behavioral Screening), Gesundheitsbewusstsein (Health Assessment) und persönliche Zielvereinbarungen (Patient Preferences) aufnimmt und Infos zu Folge- und Begleiterkrankungen (Side Effects) sowie Behandlungssicherheit (Treatment Confidence) enthält. Einzelne Module sollen sich dann für individuelle Zwecke nutzen lassen, z.B. für Wissenschaft und Forschung (Health Assessments) oder Industrie/Regulatory (Side effects).
Im weiteren Verlauf des Symposiums stellte Dr. Simone von Sengbusch ihr gefördertes Projekt ViDiKi vor, und zum Abschluss fragte der Grundlagenforscher Professor Dr. Martin Hrabě de Angelis vom Helmholtz Zentrum, München: „Big Data in der Gesundheitsforschung – Wonach suchen wir eigentlich?“ Hier nur eine sehr kurze Antwort auf diese wichtige Frage: Es geht um personalisierte Prävention und Behandlung in der Diabetestherapie.