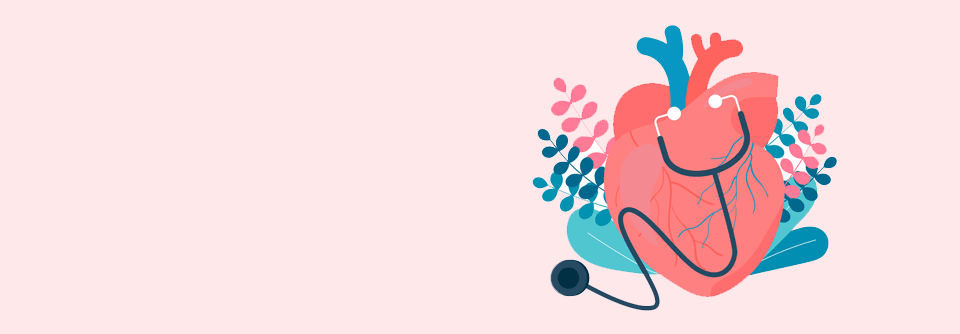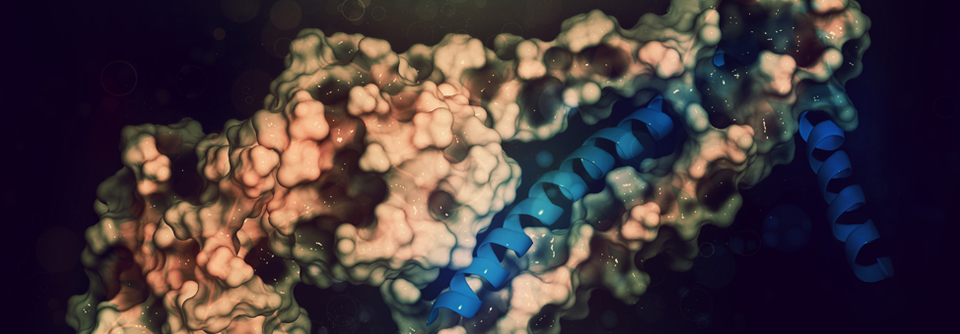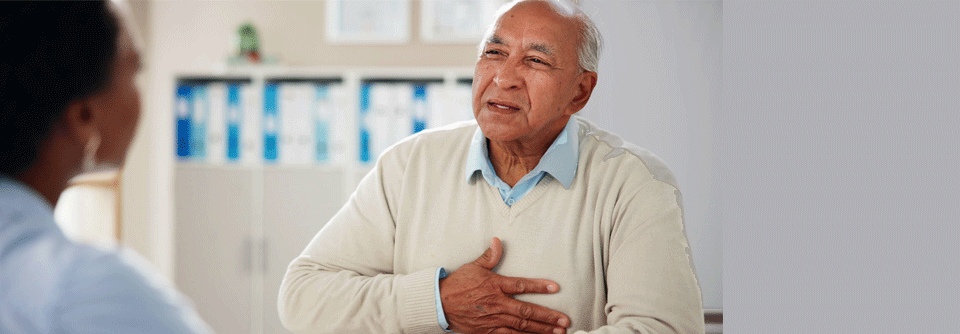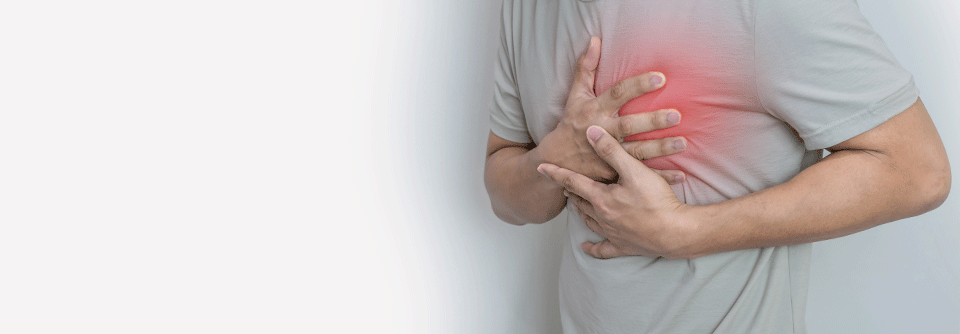
Gesundheitsprävention „Ein Herzinfarkt ist medizinisches Versagen“
 Die Gesundheitsprävention erlebt einen Wandel hin zu proaktiveren, personalisierteren Strategien.
© Sandwish - stock.adobe.com
Die Gesundheitsprävention erlebt einen Wandel hin zu proaktiveren, personalisierteren Strategien.
© Sandwish - stock.adobe.com
Viel zu oft besteht die klinische Routine aus dem Management des Endstadiums einer Gefäßkrankheit, sprich dem kardiovaskulären Ereignis. Die wahre Erkrankung sei aber die Atherosklerose, sagte Dr. Renate Michel-Lambertz vom Prevention First Zentrum Rüdesheim. Diese müsse frühzeitig erfasst werden– die bildgestützte Diagnostik und das Screening von Biomarkern (hochsensitives CRP, LDL-Cholesterin, Lipoprotein[a]) seien der geeignete Weg. Denn: „Ein Herzinfarkt ist medizinisches Versagen“, konstatierte die Kollegin.
Karotis-Ultraschall gilt als besonders alltagstauglich
Dank hochauflösender Bildgebung lassen sich nicht nur Stenosen, sondern auch vulnerable Plaques mit lipidreichem Kern und dünner Deckplatte bereits im asymptomatischen Stadium darstellen. Der hochauflösende Karotis-Ultraschall hat sich als besonders alltagstaugliche Methode etabliert. Eine erhöhte Intima-Media-Dicke ist ein wichtiger Indikator für eine subklinische Atherosklerose.
„Es gibt keine idiopathische Intima-Media-Verdickung“, erinnerte Dr. Michel-Lambertz. Die Referenzwerte für gesunde 50-jährige Frauen bzw. Männer liegen bei 0,7 mm bzw. 0,75 mm. Die Power-Doppler-Untersuchung ermöglicht zudem, echoluzente Plaques mit Rupturpotenzial zu identifizieren. Werden solche Soft-Plaques gefunden, kann die lipidsenkende Therapie intensiviert werden.
Für eine erfolgreiche Prävention braucht es jedoch mehr als eine frühzeitige Diagnostik. Patientinnen und Patienten müssen die Behandlung bei auffälligen Befunden konsequent mittragen. Dabei motivieren Bilder mehr als Worte, sagte die Referentin. Ihrer Erfahrung nach fangen sehr viele Betroffene damit an, gesünder zu leben und sich konsequent an Medikationspläne zu halten, nachdem ihnen ihre Atherosklerose vor Augen geführt wurde.
Auch metabolische Mitverursacher kardiovaskulärer Erkrankungen gilt es zu adressieren. Besonders die stoffwechselbedingte Fettleber (MASLD*) sei ein unterschätzter Risikomarker, erklärte Dr. Johannes Scholl vom Prevention First Zentrum Rüdesheim. 30–40 % der deutschen Bevölkerung weisen meist unbemerkt eine MASLD auf. Um ein erhöhtes metabolisches Risiko in der Praxis frühzeitig zu erkennen, sollte man fünf Punkte abarbeiten:
- Familienanamnese bezüglich Adipositas und Diabetes
- Bauchumfang und Waist-to-Height-Ratio
- Aktivitätsniveau (Ausdauer, Kraft, Griffkraftstärke)
- HbA1c und HOMA**-Index (zur Abschätzung von Insulinresistenz und Betazellfunktion)
- Grad der Leberverfettung (Tissue Attenuation Imaging / Tissue Scatter Imaging in der Sonografie)
Neben regelmäßiger Aktivität (siehe Kasten) spielt die Ernährung eine zentrale Rolle für einen gesunden Stoffwechsel. Von den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) riet Dr. Scholl allerdings explizit ab. Und „orientieren Sie sich nicht am Nutri-Score, den ich Nonsens nenne“, ergänzte er.
Körperliche Aktivität ist keine Lifestyle-Entscheidung
Sport kann die Folgen eines sessilen Lebensstils nachweislich abfedern. Laut einer Studie bleibt das Mortalitätsrisiko selbst bei über acht Stunden täglichem Sitzen niedrig, sofern das Fitnesslevel ausreichend hoch ist (> 35 MET*-Stunden pro Woche). Als medizinische Intervention gehört körperliche Aktivität daher zur Prävention dazu, sagte Dr. Adrian-Hennig Treiber vom Prevention First Zentrum Rüdesheim.
Die VO2max ist der aussagekräftige Fitnessindikator, der altersadjustiert interpretiert werden muss. Mit zunehmendem Alter geht ein physiologischer Rückgang einher. Jedoch gilt: Je fitter ein Mensch in jungen Jahren ist, desto schwächer fallen die natürlichen Einbußen im späteren Leben aus. Durch regelmäßiges Training lassen sich diverse relevante metabolische Marker positiv beeinflussen. Besonders effektiv sei die Kombination aus moderatem Ausdauertraining und Krafteinheiten, findet Dr. Treiber. Die körperliche Betätigung ist aber nicht nur dem Stoffwechsel zuträglich: Auch die kognitive Funktion bei Personen mit Alzheimer sowie Lebensqualität und Griffkraft von älteren Menschen mit Sarkopenie können verbessert werden.
*metabolisches Äquivalent
Wichtig sei dem Kollegen zufolge, die glykämische Last der Nahrung zu reduzieren. Dazu gehört, seltener schnell verfügbare, blutzuckerwirksame Stärke aus z. B. Brot, Nudeln, Kartoffeln oder Reis aufzunehmen.
Die Aufnahme essenzieller Aminosäuren kommt zu kurz
Die DGE-Vorgaben entsprächen dieser Realität nicht, so Dr. Scholl, ebenso wenig der Nutri-Score. Blutzuckeraktive Produkte würden mit „grüner Kennzeichung“ als unbedenklich und gesund dargestellt, was vor allem für Menschen mit (Prä-)Diabetes, Adipositas und MASLD problematisch sei. Außerdem komme in den Ernährungsempfehlungen u. a. die Aufnahme essenzieller Aminosäuren und langkettiger Omega-3-Fettsäuren zu kurz. Dr. Scholl bevorzugt daher die (eukalorische) Low-Carb-Ernährung.
*Metabolic Dysfunction-associated Steatotic Liver Disease
**Homeostasis Model Assessment