
Systemische Psychotherapie „Eine Störung gehört niemandem allein“
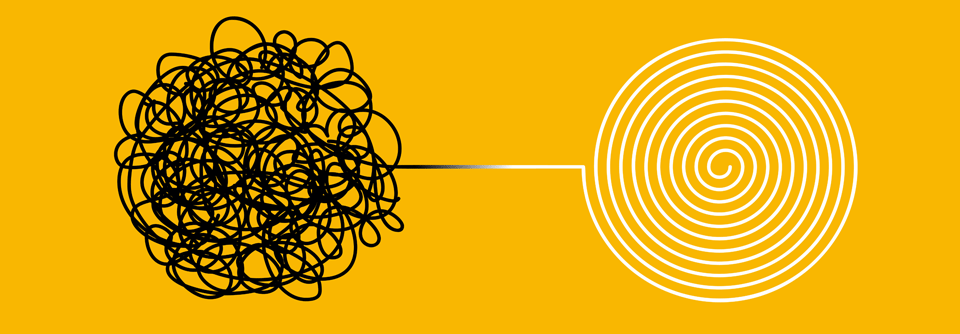 Seit ihrer Anerkennung als Richtlinienverfahren rückt die systemische Psychotherapie stärker in den Fokus.
© Alextanya - stock.adobe.com
Seit ihrer Anerkennung als Richtlinienverfahren rückt die systemische Psychotherapie stärker in den Fokus.
© Alextanya - stock.adobe.com
Wiesbaden. Seit 2020 ist die systemische Therapie in Deutschland ein anerkanntes Richtlinienverfahren für die Psychotherapie Erwachsener, 2024 folgte die Anerkennung für Kinder und Jugendliche. Doch was genau steckt hinter diesem Ansatz und wie unterscheidet er sich von anderen Verfahren? Zwei Fachleute geben Antworten.
Frau Prof. Hunger-Schoppe, Herr Braus, fangen wir einmal ganz grundlegend an: Was ist systemische Therapie überhaupt? Und was unterscheidet sie von anderen Psychotherapieverfahren?
Niels Braus: Zentral an der systemischen Herangehensweise ist die Annahme, dass psychische Symptome kein rein individuelles Phänomen sind, sondern innerhalb eines sozialen Systems entstehen. Eine Depression etwa betrifft nicht nur die Patientin selbst, sondern auch ihren Partner, vielleicht ihre Kinder, andere Familienangehörige und Freunde. Daher ist die erste Frage nicht: Wie können wir die Symptome reduzieren? Sondern: Wie ist die Störung entstanden und welche Beziehungs- und Kommunikationsmuster erhalten sie aufrecht?
Christina Hunger-Schoppe: Häufig ist es zum Beispiel so, dass Angehörige und die Partnerin für den Erkrankten stark kompensierende Rollen einnehmen und dadurch genauso stark belastet wirken, sie erhalten aber keine Diagnose oder Behandlung. Wir sagen deshalb: Eine Störung gehört niemandem allein. Wenn nur eine Person zur Therapie kommt, sehen wir nur einen Teil des Problems.
„Offener Dialog“ macht Schule
Ein systemisch geprägter Ansatz aus Finnland weckt derzeit Interesse in der Versorgungsforschung: Das Projekt „Open Dialogue“ soll eine Alternative zur klassischen psychiatrischen Akutversorgung sein. Bei den ersten Anzeichen einer Psychose (z. B. sozialem Rückzug, Unruhe, Wahrnehmungsveränderungen oder dem Gefühl, etwas „läuft aus dem Ruder“) können die Betroffenen selbst – aber auch Angehörige, Lehrkräfte oder andere Bezugspersonen – einen Hilferuf absetzen. Innerhalb von 24 Stunden wird ein Netzwerktreffen organisiert, an dem die Betroffenen, wichtige Bezugspersonen sowie mindestens zwei Fachkräfte teilnehmen.
Das erste Treffen dient einer Orientierung und dem Austausch unterschiedlicher Standpunkte. Je nach Bedarf finden weitere regelmäßige Netzwerktreffen statt oder es fällt die Entscheidung für eine Therapie, idealerweise ambulant oder mobil. Dabei wird jede Maßnahme gemeinsam im Netzwerk beschlossen.
Mehrere europäische Studien zeigen, dass dadurch die Zahl der stationären Aufnahmen von Menschen mit psychotischen Episoden deutlich sinkt. Es werden zudem weniger Psychopharmaka eingesetzt, die Betroffenen werden seltener dauerhaft arbeitsunfähig und können bessere soziale Beziehungen aufrechterhalten.
Also ist es aus Ihrer Sicht nötig, die Familie, die Partnerin oder den Partner persönlich mit einzubeziehen?
Christina Hunger-Schoppe: Unbedingt! Ein Beispiel: Ich habe eine Jugendliche behandelt, die immer einen Suizidversuch unternommen hat, sobald es ihrer älteren Schwester schlecht ging. Die jüngere landete dann in der Notaufnahme und erhielt eine Krisenintervention. Bis wir das Muster erkannt und für die ältere Schwester einen Therapieplatz bekommen haben, verging viel Zeit. Da wäre es gut gewesen, früher das Gesamtbild zu sehen.
Bei einem anderen Fall brachte eine Klientin ihre beste Freundin mit, es ging um Gewalt in der Partnerschaft. Die Betroffene meinte, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Sie war noch in einer Art Schutzmodus, sowohl sich selbst als auch ihrem Ehemann gegenüber. Die Freundin allerdings erzählte dann, was wirklich in der Beziehung los war. Das war für mich als Therapeutin sehr hilfreich. Also ja, das Mehrpersonensetting sollte Standard in der systemischen Therapie sein.
Wie lässt sich das praktisch umsetzen?
Niels Braus: Seit der Kassenzulassung ist es in Deutschland möglich und auch abrechnungsfähig, Partner, Angehörige oder andere wichtige Bezugspersonen dauerhaft einzubeziehen. Das ist ein echter Fortschritt.
Christina Hunger-Schoppe: Wobei wichtig ist: Das Mehrpersonensetting ist zwar mittlerweile für die systemische Therapie erlaubt, aber nicht angemessen vergütet. Für größere Therapiezimmer, mehr Verbrauchsmaterial und höheren Aufwand in der Vorbereitung gibt es aktuell noch nicht mehr Honorar.
Wie sieht es mit der Studienlage zur Wirksamkeit der systemischen Therapie aus? Was hat sich geändert, dass sie als Richtlinienverfahren anerkannt wurde?
Christina Hunger-Schoppe: Die lange Wartezeit auf die Kassenzulassung lag vor allem daran, dass wir berufspolitisch schlechter aufgestellt waren als andere. Dazu muss ich ein bisschen ausholen: 1999 wurde Psychotherapie in Deutschland in den Berufsstand erhoben. Verhaltenstherapie und Psychoanalyse bzw. Tiefenpsychologie waren schon in den Jahren zuvor berufspolitisch so weit professionalisiert, dass sie ungeprüft mitgenommen wurden. Die systemische Therapie kam zu spät und musste den offiziellen Weg gehen.
Im Jahr 2000 gab es die erste Prüfung durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie. Die Evidenz zur Wirksamkeit war da insgesamt schon positiv, es mangelte aber an ausreichend randomisiert-kontrollierten Studien. Das hatte sich bis zur zweiten Prüfung 2007 geändert. Seitdem dürfen wir uns offiziell „evidenzbasiert“ nennen; seit 2008 kann man als systemischer Therapeut eine Approbation erhalten. Dann hat es aber noch einmal zehn Jahre gedauert bis zur Anerkennung als Kassenleistung.
Niels Braus: Das bedeutet auch: Die systemische Therapie wurde als einziges der aktuell verbreiteten Verfahren offiziell auf ihre Evidenz geprüft. Aber es ist deshalb kein neues Verfahren. Die Wurzeln reichen zurück bis in die 1950er-Jahre.
Wie unterschiedlich ist das, was Patientinnen und Patienten erhalten, wenn „systemische Therapie“ auf dem Praxisschild steht?
Niels Braus: Da gibt es schon Unterschiede, sowohl zwischen den Ausbildungsinstituten als auch regional. In einem aktuellen Forschungsprojekt haben wir etwa gesehen, dass manche Institute den Fokus eher auf die Einzeltherapie legen, während andere vor allem die Paar- und Familientherapie hochhalten. Das ist insofern interessant, als die meisten Evaluationsstudien die systemische Psychotherapie im Paar- oder Familiensetting untersucht haben. Evidenzbasiert wäre es daher, diese Herangehensweise auch standardmäßig anzuwenden, was noch nicht überall der Fall ist.
Allerdings wird in anderen Schulen auch nicht immer nach der reinen Lehre gehandelt. Interessant fand ich etwa, dass die Expositionsbehandlung – wenn man so möchte, das klassischste Verfahren der Verhaltenstherapie – in der Versorgung lange nicht so häufig umgesetzt wird, wie es der Evidenz nach passieren müsste. Da stehen, ähnlich wie beim Thema Mehrpersonensetting in der systemischen Therapie, ganz oft einfach praktische Gründe im Weg. Deswegen ist die grundlegende Frage: Wie kriegen wir das, was in Studien für wirksam befunden wurde, auch in die Praxis implementiert? Das gilt für alle Therapieschulen.
Ist die systemische Therapie für alle Arten von psychischen Störungen geeignet? Oder würden Sie eine Person z. B. mit einer Psychose eher weiterschicken?
Niels Braus: Gerade nicht! Historisch gesehen haben sich vor allem die Systemiker in den USA viel mit eher „harten“ und oft chronifizierten Störungen beschäftigt, etwa Schizophrenie und Psychosen. Deshalb gibt es auch für diese Krankheitsbilder gute Studien zur Wirksamkeit.
Christina Hunger-Schoppe: Die systemische Therapie hat sich oft zuerst um die Störungen gekümmert, für die es zu der jeweiligen Zeit noch keine anderen Behandlungskonzepte gab: Essstörungen, Schizophrenie, dissoziales Verhalten bei Jugendlichen. „Schwere Fälle“ – auch wenn der Begriff nicht ganz unproblematisch ist – haben bei uns also eine lange Tradition.
Quelle: Medical-Tribune-Interview



