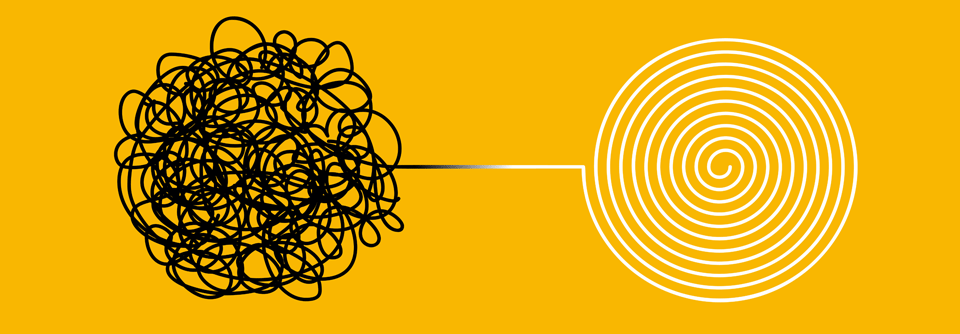Chronischer Schmerz und Hirnnetzwerke Psychotherapie wirkt direkt im Schmerzgehirn
 Einer von fünf Menschen hat irgendwann in seinem Leben mit chronischen Schmerzen zu kämpfen. Medikamente helfen dabei oft nur wenig.
© Aleksandra - stock.adobe.com
Einer von fünf Menschen hat irgendwann in seinem Leben mit chronischen Schmerzen zu kämpfen. Medikamente helfen dabei oft nur wenig.
© Aleksandra - stock.adobe.com
Einer von fünf Menschen hat irgendwann in seinem Leben mit chronischen Schmerzen zu kämpfen. Medikamente helfen dabei oft nur wenig. Stattdessen können psychologische Interventionen Besserung bringen. Das gelingt inzwischen auch via Internet oder Smartphone-App.
Die Schmerzempfindung ist immer eine individuelle Wahrnehmung, die durch biologische, psychologische und soziale Faktoren beeinflusst wird, schreiben Prof. Dr. Lene Vase von der Universität Aarhus und ihr Team. Die ICD-11-Klassifikation grenzt primäre chronische Schmerzen als eigenständiges Krankheitsbild, z. B. bei der Fibromyalgie, von sekundären chronischen Schmerzen, die mit einer anderen Krankheit wie Krebs assoziiert sind, ab.
Heute unterscheidet man drei Hauptmechanismen der Schmerzentstehung: Nozizeptiver Schmerz wird durch Gewebeschädigung ausgelöst, neuropathischer Schmerz durch eine Schädigung somatosensorischer Nerven. Als relativ neue Kategorie gilt der noziplastische Schmerz, der auf eine fehlregulierte Schmerzverarbeitung ohne nachweisbaren Gewebe- oder Nervenschaden zurückgeht.
An der Schmerzwahrnehmung beteiligt sind Signalwege für Entscheidungsfindung, autobiografisches Gedächtnis und Selbstregulation. Im Gehirn finden nach einer Gewebeschädigung neuronale Veränderungen statt, die zu einer Chronifizierung der Schmerzempfindung führen können.
Schmerzhemmende neuronale Bahnen werden geschwächt
Zahlreiche Mechanismen spielen bei der sensorisch-diskriminativen, der motivational-affektiven und der kognitiv-evaluativen Komponente der Schmerzempfindung zusammen. Es kommt z. B. zu einer Sensibilisierung des aufsteigenden nozizeptiven Systems und zu einer Schwächung der absteigenden schmerzhemmenden Bahnen. Eine Interaktion mit medialen präfrontalen Systemen wiederum steuert schmerzbezogenes Verhalten, Affekte, Motivation und Selbstreflexion.
Es gibt eine Reihe von psychologischen Interventionen, um Schmerzwahrnehmung und Verhalten zu beeinflussen. Sie zielen darauf ab, nicht hilfreiche Emotionen, Einstellungen und Verhaltensformen zu identifizieren und diese durch besser geeignete zu ersetzen. Der Fokus der Betroffenen soll von der Beschäftigung mit dem Schmerz zu anderen Aktivitäten umgelenkt werden.
Am besten belegt ist die Wirkung der kognitiven Verhaltenstherapie. Nach einer Cochrane-Metaanalyse bringt sie eine kleine, aber konsistente Besserung. Nur wenige randomisierte kontrollierte Studien haben versucht, zugrunde liegende neurobiologische Mechanismen zu analysieren. Neuroimaging-Studien weisen darauf hin, dass sich die Wirkung der psychologischen Interventionen in Veränderungen in bestimmten Hirnarealen und Netzwerken widerspiegelt, die an der Schmerzleitung beteiligt sind.
Die wenigsten Schmerzgeplagten können persönlich von einer qualifizierten Psychologin oder einem Psychologen schmerztherapeutisch betreut werden. Um mehr Menschen zu erreichen, wurden internetbasierte und appbasierte Tools entwickelt. Eine Cochrane-Metaanalyse aus 2023 wertete 32 randomisierte kontrollierte Studien aus, die die Wirksamkeit solcher Tools untersuchten. In den meisten Studien ging es um kognitive Verhaltenstherapien.
Insgesamt wurde ein positiver Einfluss auf Schmerzintensität, funktionelle Behinderung und Lebensqualität gefunden im Vergleich zu gar keiner Therapie. Der Effekt könnte allerdings dadurch überschätzt werden, dass in solchen Studien eine Verblindung und adäquate Placebokontrolle kaum möglich ist.
Biopsychosoziales Modell möglichst früh anwenden
Menschen mit chronischen Schmerzen suchen früher oder später ärztliche Hilfe. Die konsultierten Ärztinnen und Ärzte sollten die Herausforderung annehmen und die Schmerzleidenden nach dem biopsychosozialen Modell anleiten. Je früher dies geschieht, desto besser lassen sich Chronifizierungen verhindern.
Entscheidend ist, die geschilderten Schmerzen als real anzuerkennen und der Patientin oder dem Patienten eine vertrauensvolle Partnerschaft anzubieten. Um Schmerzpatientinnen und -patienten die Herkunft ihrer Schmerzen verständlich zu erklären, kann man von dysregulierten Gehirnnetzwerken sprechen. Zweiter Schritt sollte sein, ihre Ansichten und Einschätzungen zu den Schmerzen genau zu erfragen, und einen Eindruck zu gewinnen, wie starr sie daran festhalten.
Dann kann man damit beginnen, den Glauben, dass das „Leidenmüssen“ eine ausweglose Konsequenz der Schmerzen ist, aufzuweichen und neue Ideen zum Selbstmanagement vorzuschlagen. So kann der Fokus vom Schmerz in Richtung Funktion gelenkt werden sowie auf Aktivitäten im Leben, die Freude machen. Wichtig sind dabei realistische Ziele. Gemeinsam werden neue Copingstrategien entwickelt, z. B. zu laufen, anstatt sich vom Schmerz übermannen zu lassen.
Eine langfristige fachliche Begleitung ist unverzichtbar
Die Patientinnen oder Patienten müssen auf dem Weg, einen besseren Umgang mit den Schmerzen zu erlernen, langfristig begleitet werden. Dabei gilt es unter anderem, sich gemeinsam über eine Besserung zu freuen und auch Halt bei Rückschlägen zu bieten. Das Schlimmste, was man einem Menschen mit chronischen Schmerzen sagen kann, ist, man könne nichts für ihn tun, mahnt das Autorenteam.
Quelle: Vase L et al. Lancet 2025; 405: 1781-1790; doi: 10.1016/S0140-6736(25)00404-0