
Endoskopische Remission anstreben Endoskopische Remission verbessert Langzeitprognose
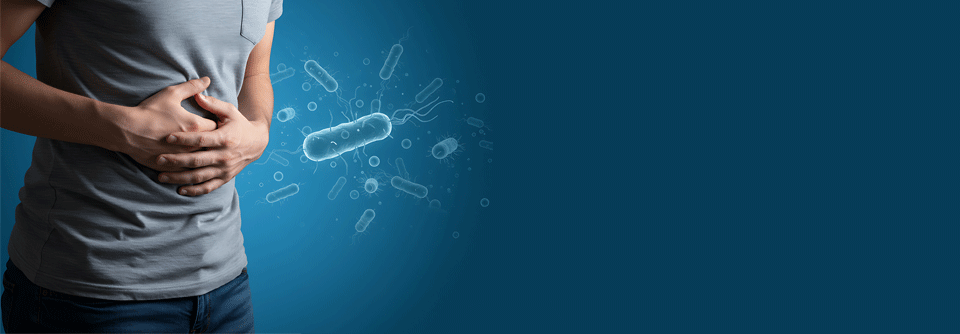 Die Endoskopie spielt eine zentrale Rolle bei der Diagnose, Verlaufskontrolle und Nachsorge von Patientinnenen und Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen.
© Ai Images Stock - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Die Endoskopie spielt eine zentrale Rolle bei der Diagnose, Verlaufskontrolle und Nachsorge von Patientinnenen und Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen.
© Ai Images Stock - stock.adobe.com (Generiert mit KI)
Die Endoskopie spielt eine zentrale Rolle bei der Diagnose, Verlaufskontrolle und Nachsorge von Patientinnenen und Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Doch nicht immer stimmen die endoskopischen Befunde mit der klinischen Bewertung der Krankheitsaktivität überein. So kann beispielsweise in manchen Fällen trotz einer klinischen Remission endoskopisch weiterhin eine Entzündungsaktivität nachgewiesen werden.
Die endoskopische Remission ist das langfristige Therapieziel in der Behandlung von CED-Erkrankten, da sie mit einer verbesserten Langzeitprognose und einem komplikationsärmeren Verlauf der Erkrankungen assoziiert ist. Das erklären Prof. Dr. Timo Rath und Prof. Dr. Markus Neurath vom Uniklinikum Erlangen im Rahmen einer aktuellen Übersichtsarbeit. Dabei gehen die beiden Experten unter anderem auf die wichtigsten Scoring-Systeme zur Graduierung der Entzündungsaktivität ein.
Der Mayo Endoscopy Score (MES) zählt zu den gängigsten Scores zur Beurteilung der Entzündungsaktivität bei Colitis ulcerosa. Er ist eine Untereinheit des eigentlichen Mayo-Scores, in der das endoskopische Erscheinungsbild auf einer Skala von vier Punkten bewertet wird:
- MES 0: normale Mukosa
- MES 1: reduziertes Gefäßmuster, Schleimhauterythem, leichte Sprödigkeit („Friability“) der Mukosa
- MES 2: deutliches Erythem, Sprödigkeit der Schleimhaut, aufgehobenes Gefäßmuster, Erosionen
- MES 3: Ulzerationen und spontane Schleimhautblutungen
Während laut Konsensempfehlungen ein MES = 0 als Therapieziel angestrebt werden sollte, wird in vielen klinischen Studien eine endoskopische Remission als MES ≤ 1 Punkt definiert.
Ein neueres endoskopisches Bewertungssystem für die Krankheitsaktivität bei Colitis ulcerosa ist der Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity (UCEIS). Obwohl er gut mit dem MES korreliert, kann er durch die feinere Abstufung Veränderungen unter der Therapie wahrscheinlich sensitiver abbilden. Bewertet werden Gefäßmuster (0–2 Punkte), Blutungen (0–3 Punkte) sowie Tiefe und Größe der Ulzerationen (0–3 Punkte). Somit ergibt sich ein Maximalwert von 8 Punkten. Eine endoskopische Remission besteht laut Definition ab einem UCEIS < 2.
Für die endoskopische Beurteilung der Krankheitsaktivität bei Morbus Crohn hat sich der Simple Endoscopic Score for Crohn’s Disease (SES-CD) etabliert. Er setzt sich aus der Summe der Punktzahl von folgenden Kriterien zusammen, die jeweils mit 0 bis 3 Punkten bewertet werden:
- Anwesenheit und Größe von Ulzera
- Anteil der ulzerierten Oberfläche
- Anteil der entzündeten Oberfläche
- Anwesenheit und Art von Stenosen
Bislang gibt es für diesen Score keine genaue Definition für eine endoskopische Remission. In Konsensempfehlungen findet sich der Vorschlag, einen Grenzwert von SES-CD < 3 heranzuziehen.
Insbesondere nach einer erfolgten Ileozökalresektion bietet sich darüber hinaus der modifizierte Rutgeerts-Score (mRS) an. Da er die Abschätzung des Rezidivrisikos nach dem Eingriff ermöglicht, ist er für die Prognose relevant.
Menschen mit langjähriger Colitis ulcerosa und Morbus-Crohn-Erkrankte mit Kolonbeteiligung (Colitis Crohn) tragen ein erhöhtes Risiko, ein kolorektales Karzinom zu entwickeln. Deshalb empfehlen alle aktuellen Leitlinien, regelmäßig Überwachungskoloskopien bei den Betroffenen durchzuführen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechsel-Erkrankungen (DGVS) sollten die Intervalle für diese Untersuchungen je nach Risikoprofil zwischen einem und vier Jahren liegen.
Die bevorzugte Methode ist dabei die farbstoffbasierte Chromoendoskopie. Alternativ bietet sich die hochauflösende Weißlichtendoskopie an, wobei besondere Sorgfalt und eine ausreichende Rückzugszeit vorausgesetzt werden. Neue endoskopische Mikroskopiesysteme wie die Endozytoskopie oder die konfokale Laserendomikroskopie ermöglichen laut denr Autoren eine präzise feingewebliche Bildgebung während der laufenden Untersuchungen – und teilweise auch eine funktionelle Beurteilung der Darmbarriere, mit prognostischer Relevanz.
Quelle: Rath T, Neurath MF „Endoskopie bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen: Neues und Bewährtes“, Dtsch Med Wochenschr 2025; 150: 419-426; doi: 10.1055/a-2344-7995 © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, New York



