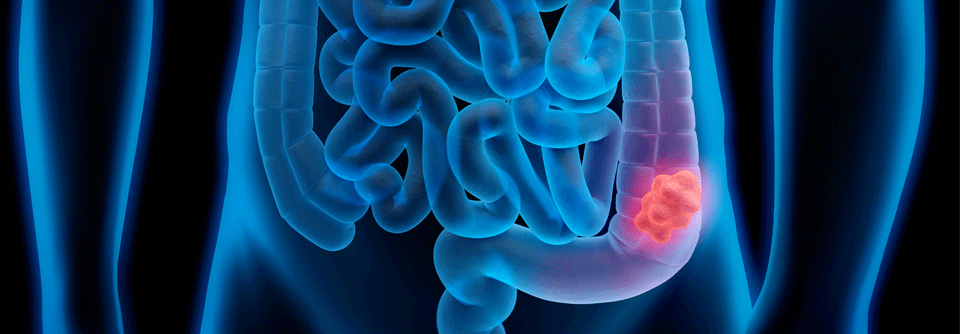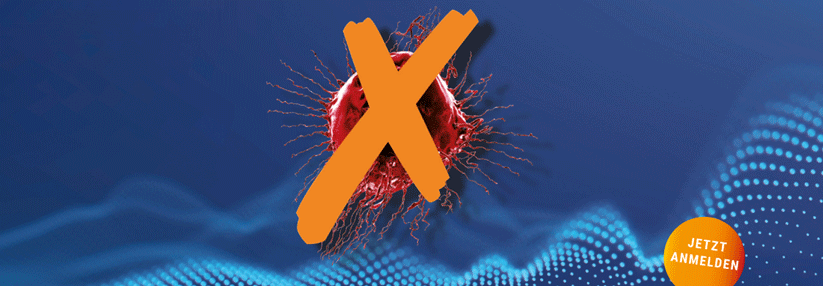
Erfolgreiche Integration Hilfreiche KI in der Nephropathologie
 KI-Algorithmen können Pathologinnen und Pathologen bei solchen Fragen unterstützen, indem sie etwa bösartig veränderte Bereiche in digitalisierten Gewebspräparaten hervorheben.
© Pawel - stock.adobe.com
KI-Algorithmen können Pathologinnen und Pathologen bei solchen Fragen unterstützen, indem sie etwa bösartig veränderte Bereiche in digitalisierten Gewebspräparaten hervorheben.
© Pawel - stock.adobe.com
Künstliche Intelligenz (KI) kommt immer häufiger auch in der medizinischen Diagnostik zum Einsatz. Doch in vielen Bereichen wird ihr Potenzial noch kaum genutzt. Dass es auch anders geht, demonstriert ein Kooperationsprojekt des Uniklinikums Erlangen, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und des Gravina Hospitals in Caltagirone in Italien. Es zeigt, wie sich KI nahtlos in den klinischen Alltag einer voll digitalisierten Pathologie-Abteilung integrieren lässt. Die Ergebnisse wurden nun in der Fachzeitschrift Genome Medicine veröffentlicht [1].
Jahr für Jahr werden mehr als 1,4 Millionen Menschen in Deutschland wegen einer Krebserkrankung im Krankenhaus behandelt. Wird ihnen in einer Operation der Tumor entfernt, erfolgt danach meist in der Pathologie eine Untersuchung des entnommenen Gewebes: Um welche Krebsart handelt es sich genau? Ist die Wucherung bösartig? Sollte unterstützend eine Chemotherapie erfolgen, und wenn ja, mit welchen Medikamenten?
Potenzial der KI-Algorithmen zu wenig genutzt
KI-Algorithmen können Pathologinnen und Pathologen bei solchen Fragen unterstützen, indem sie etwa bösartig veränderte Bereiche in digitalisierten Gewebspräparaten hervorheben. Doch wird ihr Potenzial heute oft noch wenig genutzt. Das hat unter anderem etwas mit der Untersuchungsmethodik zu tun: Während Magnetresonanztomograf (MRT) oder Ultraschallgerät digitale Bilder produzieren, die sich direkt durch eine KI auswerten lassen, ist das bei einem Gewebeschnitt anders. „Bislang erfolgt die Untersuchung in der Regel am Mikroskop“, erklärt PD Dr. Fulvia Ferrazzi, die in der Nephropathologischen Abteilung (Leiterin: Prof. Dr. Kerstin Amann) und am Pathologischen Institut (Direktor: Prof. Dr. Arndt Hartmann) des Uniklinikums Erlangen die Arbeitsgruppe für Bioinformatik und Computergestützte Pathologie leitet. „Die Digitalisierung von histopathologischen Präparaten in hochauflösende Bilder ist noch die Ausnahme.“
Das Department für Pathologie (Direktor: Dr. Filippo Fraggetta) des Gravina-Hospitals im italienischen Caltagirone ist an dieser Stelle schon weiter – dort werden inzwischen alle Gewebeschnitte routinemäßig digitalisiert. „Das Problem ist hier also nicht die Verfügbarkeit digitaler Daten“, sagt Miriam Angeloni, die in Ferrazzis Arbeitsgruppe promoviert. „Stattdessen gab es bislang noch keine Möglichkeit, diese Daten automatisch mit Deep-Learning-Modellen zu analysieren.“ Daher sind KI-Tools noch nicht routinemäßig in die klinische Diagnostik integriert. „Wir haben untersucht, wie sich der Einsatz dieser Werkzeuge reibungsärmer gestalten lässt.“
Wie funktioniert eine vollständig digitalisierte Pathologie- Abteilung?
Wenn eine Gewebeprobe im Pathologielabor des Gravina- Hospitals eintrifft, durchläuft sie mehrere Verarbeitungsschritte. Zunächst werden daraus in der Regel mehrere hauchfeine Schnitte angefertigt, auf dünnen Glasplatten fixiert und mit unterschiedlichen Chemikalien angefärbt. Danach werden hochaufgelöste Digitalbilder dieser Schnitte angefertigt. Die Beschäftigten können über das Labor-Informationssystem (LIS) direkt auf diese Aufnahmen zugreifen. Die Diagnose erfolgt dann nicht wie sonst üblich am Mikroskop, sondern an einem Computermonitor.
In dem Kollaborationsprojekt haben die Forschenden nun ein Verfahren entwickelt, bei dem sich die KI-Analyse automatisch in diesen Arbeitsablauf einklinkt: Sobald im LIS neue Scans eingehen, werden alle für die Analyse erforderlichen Informationen automatisch an einen Server mit verschiedenen KI-Modellen übermittelt. Dort werden dann je nach verwendeter Färbemethode und dem Gewebe, aus dem die Probe stammt, die passenden Algorithmen ausgewählt. Zusätzlich zu diesem Standard-Ablauf haben die Pathologinnen und Pathologen auch die Möglichkeit, direkt aus dem LIS eine „On-Demand“-Analyse anzufordern.
Genauigkeit der Algorithmen verbessern
Die Ergebnisse der Auswertung werden danach an das LIS zurückgespielt. Dort können die Vorhersagen der Algorithmen als sogenannte „Heatmaps” visualisiert werden. Mit diesen farbigen Überlagerungen lassen sich zum Beispiel krebsartige Regionen auf dem digitalisierten Gewebeschnitt hervorheben.
„Gemeinsam mit unseren Kollaborationspartnerinnen und -partnern wollen wir den entwickelten Arbeitsablauf auch nutzen, um die integrierten Deep-Learning-Modelle klinisch zu validieren“, erklärt Fulvia Ferrazzi. Ziel ist es, die Treffsicherheit der Algorithmen in Zukunft weiter zu verbessern. „Wir hoffen zudem, dass unser Kollaborationsprojekt die Integration von Deep-Learning- Modellen in die Routine-Diagnostik anderer Pathologie-Abteilungen fördern kann.“
Fazit
Das Kooperationsprojekt demonstriert, wie KI-Algorithmen erfolgreich in die Routine-Diagnostik einer digitalisierten Pathologie-Abteilung integriert werden können. Durch automatische Analyse digitalisierter Gewebeschnitte und Visualisierung als Heatmaps wird das Potenzial der KI in der Krebsdiagnostik praktisch erschlossen. Diese Lösung könnte als Modell für andere Pathologie-Abteilungen dienen.
Quelle: 1. https://doi.org/10.1186/s13073-025-01484-y