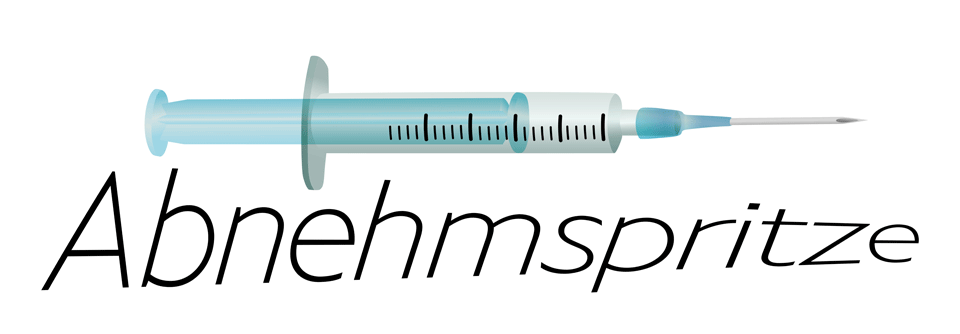
Streit um Adipositastherapie Inkretinmimetika: Heilsbringer oder nicht?
 Adipositas ist als chronische Krankheit anerkannt.
© Ljupco Smokovski - stock.adobe.com
Adipositas ist als chronische Krankheit anerkannt.
© Ljupco Smokovski - stock.adobe.com
Medikamente sind endlich die Lösung, sagt der eine. Man muss viel früher ansetzen, mahnt der andere. In einer Debatte um das beste Management der Adipositasepidemie wollte sich zwischen zwei Kollegen keine rechte Einigkeit einstellen.
Adipositas wird heute als chronisch-rezidivierende, multifaktoriell bedingte Krankheit anerkannt. Als solche verdient sie genau wie ein erhöhtes LDL oder der Diabetes eine optimale Therapie, betonte Prof. Dr. John Deanfield vom University College London. „Die Biologie, nicht der Wille, ist das Problem.“ Ratschläge zu Ernährung, Bewegung etc. werden weiterhin gebetsmühlenartig vorgetragen, doch ein (langfristiger) Erfolg bleibt in der Regel aus. Prof. Deanfield brach daher eine Lanze für Inkretinmimetika. Nicht nur lasse sich damit ein größerer Gewichtsverlust als mit einer Lebensstiländerung erzielen, die Medikamente hätten auch einen deutlich stärkeren positiven Einfluss auf Komorbiditäten. Nach Ansicht des Experten stehen die Substanzen zudem nicht in Konkurrenz zur Lebensstilmodifikation, sondern fördern diese vielmehr.
Seine Aussagen unterstrich er mit mehreren Studien. Darin zeigte sich u. a., dass mit Lebensstilmaßnahmen höchstens ein Gewichtsverlust von 5–10 % zu erreichen ist. Mit Semaglutid waren es dagegen 15 %, mit dem GIP/GLP1-Rezeptoragonisten Tirzepatid 19 %. Diese Effekte hielten über zwei bzw. drei Jahre an. Für Prof. Deanfield sind die Präparate keine „Abnehmspritzen“, sondern krankheitsmodifizierende Medikamente. „Sie senken den Blutdruck, bessern das Lipidprofil, optimieren die glykämische Kontrolle und dämpfen inflammatorische Prozesse – wirken also auf das gesamte kardiometabolische Risikospektrum.“ Interessanterweise hängt das Ausmaß der Risikoreduktion dabei nicht vom Ausgangsgewicht oder dem Gewichtsverlust ab.
Verfügbarkeit und Kosten weiterhin ein Problem
Schwere Nebenwirkungen treten selten auf. Die typischen gastrointestinalen Begleiterscheinungen, über die 20–30 % der Nutzerinnen und Nutzer berichten, sind in der Regel transient. Die oft diskutierte Frage, ob man die Medikamente absetzen kann, bereitet Prof. Deanfield wenig Kopfzerbrechen. Man sollte das Ganze als Langzeitbehandlung betrachten – wie bei einer Hypertonie oder Hypercholesterinämie. Eventuell komme eine Intervall- bzw. Pulstherapie oder die Gabe von Mikrodosen in Frage. Ein viel größeres Problem sieht der Kollege in der Verfügbarkeit und Finanzierung. Zu diesen Punkten dürfte gesundheitspolitisch noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten sein.
Prof. Dr. Nikolaus Marx von der Uniklinik RWTH Aachen bestritt nicht die positiven Effekte der Substanzen. Für ihn kommen sie aber zu spät im Krankheitsverlauf. „In allen Studien, die Effekte auf Symptome und Prognose geprüft haben, hatten die Teilnehmenden bereits kardiovaskuläre Erkrankungen“, kritisierte er. Zur Frage, ob sich die Prognose von Adipösen ohne derartige Komorbiditäten durch die Therapie bessern lässt, gebe es kaum Evidenz. Auch fehle es an Langzeitdaten.
Ein weiterer Kritikpunkt betraf die schlechte Adhärenz. Aus Real-World-Daten zu den Substanzen geht hervor, dass mehr als die Hälfte der Menschen, die GLP1-Analoga zur Gewichtsreduktion benutzen, sie binnen eines Jahres absetzen. Laut Prof. Marx gilt es, den Übergewichtstsunami im Vorfeld zu stoppen. „Wir müssen bei Kindern und Jugendlichen anfangen“, so der Experte. Globale Strategien, die auf eine gesunde Ernährung und ausreichende körperliche Aktivität abzielen, seien nötig, damit immer weniger Menschen überhaupt erst adipös werden.
* European Society of Cardiology
Quelle: SC* Congress 2025



