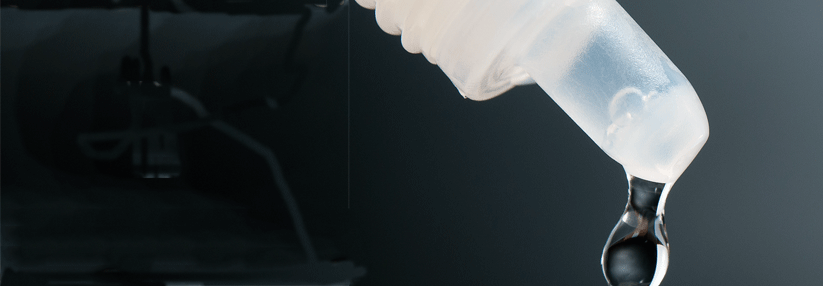
KI in Allergologie & Immunologie KI-Prototypen: 6 Schritte zur Praxis in Allergologie
 Bislang wird die Technologie in der alltäglichen Allergologie und Immunologie nur zögerlich eingesetzt.
© Alexander Limbach – stock.adobe.com
Bislang wird die Technologie in der alltäglichen Allergologie und Immunologie nur zögerlich eingesetzt.
© Alexander Limbach – stock.adobe.com
Obwohl die Zuhilfenahme von Künstlicher Intelligenz in der Medizin rasant voranschreitet, wird die Technologie in der alltäglichen Allergologie und Immunologie bislang nur zögerlich eingesetzt. Fachleute schlagen eine Strategie vor, um dies zu ändern.
Die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Allergologie und Immunologie sind laut Studienergebnissen vielversprechend: Eine Nahrungsmittelallergie ließe sich eventuell über die elektronische Patientenakte prognostizieren, Anaphylaxien anhand von Krankenhauseinträgen erkennen sowie immunologische Therapien deutlich besser individualisieren und monitorieren. Ein Autorenteam um Merlijn van Breuge lvon der Universität Groningen verweist darauf, dass zwar bis Mitte 2024 über 1.000 KI-fähige Medizinprodukte von der US-amerikanischen FDA zugelassen wurden, keines davon jedoch spezifisch für Allergologie und Immunologie. Woran liegt das?
Bildauswertende Verfahren, die KI-Entwicklungen maßgablich vorangetrieben haben, kommen in der Allergologie und Immunologie nur begrenzt zum Einsatz, vermutet die Autorengruppe als einen Grund. Das internationale Expertenteam hat anhand der jüngsten Entwicklungen im Bereich der KI einen Sechs Punkte-Fahrplan entwickelt, um die allergologische und immunologische Praxis langfristig auf den technologisch neuesten Stand zu bringen. Den Menschen ersetzen werden, sie allerdings auf absehbare Zeit nicht.
Schritt 1: Priorisieren der wichtigen Anwendungsmöglichkeiten
Die meisten Untersuchungen befassen sich derzeit mit KI-Lösungen für kleinere Probleme bzw. für solche, für die es bereits Lösungen gibt. Dazu gehört beispielsweise die Diagnose von Asthma bei Jugendlichen. Ein größerer Zugewinn für die Praxis wäre hingegen, wenn man die KI für Fragestellungen einsetzt, bei denen gängige Methoden scheitern, wie die Asthmadiagnose bei Vorschulkindern. Aussichtsreich scheint diesbezüglich die Auswertung von Daten z. B. aus Patientenakten oder von tragbaren Sensoren, zur saisonalen Exposition und kombinierte Analysen mit Multi-omics-Ansätzen. Letztere wurden z. B. im Rahmen der KI-Plattform PandaOmics bereits genutzt, um mögliche neue Therapieziele (IL-4R, IL-5, JAK und NR3C1) bei allergischen Erkrankungen zu identifizieren.
Schritt 2: Klinisch relevante Standards definieren
Für die Leistungsbeurteilung von Anwendungen braucht es nicht nur kontrollierte Studienszenarien, betont die Expertengruppe. Es müssen eindeutige Kriterien aus der klinischen Praxis festgelegt werden, anhand derer sich KI-Systeme beurteilen lassen. Darüber hinaus müssen Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und Durchführbarkeit der Methoden in den Studien eine Rolle spielen.
Schritt 3: Standards für Validierung und Qualitätssicherung schaffen
Die Wirksamkeit von KI-Tools wird derzeit meist in einzelnen Kohorten und nur bis zu einem gewissen Grad über randomisierte klinische Studien getestet, schreiben die Expertinnen und Experten. Allerdings könne man nur mit realen Patientenpopulationen den tatsächlichen Erfolg der Umsetzung messen. Darüber hinaus müssen rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, um den verantwortungsvollen Einsatz von KI im Gesundheitswesen zu gewährleisten. Ein bedeutsamer Schritt in diese Richtung wurde bereits mit dem Inkrafttreten des KI-Gesetzes der Europäischen Union gemacht.
Schritt 4: Übergang in die klinische Umsetzung beschleunigen
Um das Potenzial von KI-Prototypen ausschöpfen und sie in den klinischen Alltag bringen zu können, braucht es Strategien zur fachübergreifenden Bündelung von Ressourcen und Expertise. Dabei muss man das Rad aber nicht jedes Mal neu erfinden. Um Algorithmen in bestehende Arbeitsabläufe effektiv integrieren zu können, gibt es Gerüste aus validierten Prozessen, sogenannte Frameworks. Frameworks wie SALIENT (provisional staged AI implementation framework) geben dem neu entwickelten Algorithmus z. B. bewährte Strukturen, Arbeits und Dokumentationsschritte vor. So lässt sich die Implementierung in das Gesundheitswesen sicher gestalten. Allerdings müsste ein bestehendes Framework wie SALIENT deutlich an die speziellen Anforderungen in der Allergologie und Immunologie angepasst werden, fügt die Autorengruppe hinzu. Damit gemeint sind z. B. Aspekte wie das Zusammenspiel von individuellen externen Faktoren bei allergischen Erkrankungen, verschiedene Phänotypen oder im zeitlichen Verlauf veränderliche Sensibilisierungsmuster und klinische Outcomes.
Schritt 5: Integration der KI in alltägliche Prozesse
„Ein Arzt muss die interne Funktionsweise eines MRT nicht vollständig verstehen, um es effektiv nutzen zu können“, schreibt das Autorenteam. Damit spielen sie auf die Tatsache an, dass es mit zunehmender Komplexität immer schwieriger wird, Algorithmen für Außenstehende nachvollziehbar zu erklären. Wie das Beispiel zeigt, wäre das für Ärztinnen und Ärzte allerdings auch nicht unbedingt zwingend. Berücksichtigt werden sollte aber, dass es viele eher weniger KI-erfahrene Anwenderinnen und Anwender gibt. Auch in diesem Fall könne man auf unterstützende Frameworks zurückgreifen. Das NASSS-Framework (nonadoption, abandonment, scaleup, spread, and sustainability) ist beispielsweise darauf ausgelegt, solche Hürden bei der Einführung von komplexen Projekten zu identifizieren und für die Entwicklung von Lösungsstrategien zu berücksichtigen.
Schritt 6: Eingeführte KI-Systeme überwachen und systematisch aktualisieren
Nach Einführung eines KI-Assistenten in die klinische Praxis wird ein Management benötigt, das sowohl die Leistung überwacht als auch Protokolle systematisch aktualisiert. Dabei sollten neben diagnostischer Genauigkeit auch Kosteneffizienz und Datenabweichungen geprüft werden. „Genauso wie Ärztinnen und Ärzte eine kontinuierliche medizinische Fortbildung benötigen, müssen KI-Systeme regelmäßig aktualisiert werden. Dabei geht es darum, neue klinische Erkenntnisse sowie überarbeitete Behandlungsrichtlinien und Anpassungen an sich verändernde Rahmenbedingungen zu berücksichtigen“, schreibt das Team um van Breugel.
Quelle: Dr. Melanie Söchtig van Breugel M et al. J Allergy Clin Immunol 2025; doi: 10.1016/j.jaci.2025.08.022



