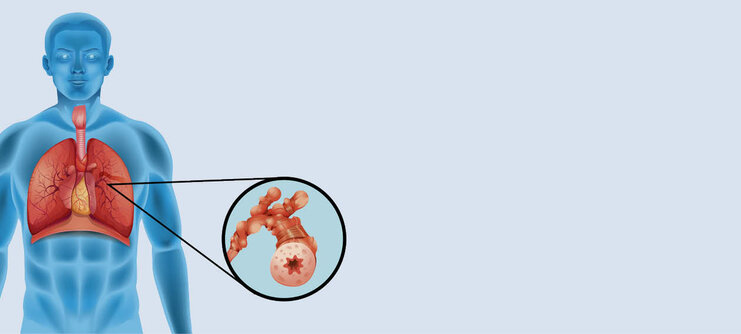Organoide in der Lungenforschung Lungenorganoide liefern Erkenntnisse zu Atemwegserkrankungen
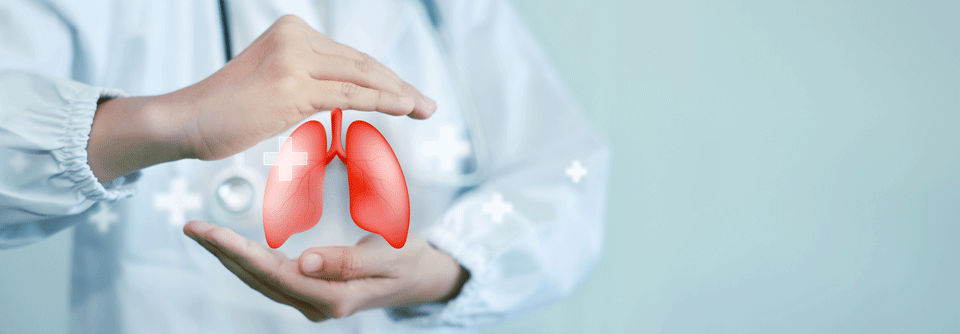 Lungenorganoide haben sich als Modelle zur Erforschung von Atemwegserkrankungen im Kindesalter bewährt.
© TripleP Studio - stock.adobe.com
Lungenorganoide haben sich als Modelle zur Erforschung von Atemwegserkrankungen im Kindesalter bewährt.
© TripleP Studio - stock.adobe.com
Pulmonale Organoide gelten als Brücke zwischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendung. Mit ihnen lässt sich sowohl die Entwicklung als auch die physiologische Umgebung der Lunge nachahmen. Sie ermöglichen neue Erkenntnisse zur Entstehung von Krankheiten und deren Behandlung.
Die Ergebnisse aus Tiermodellen zur Erforschung von Krankheiten und Therapien sind nur begrenzt auf den Menschen übertragbar und werden unter ethischen Aspekten zunehmend kritisch gesehen. Herkömmliche zweidimensionale Zellkulturen spiegeln wiederum die Komplexität von Geweben und Organen nicht wider. Seit rund zehn Jahren gelingt es Forschenden immer besser, dreidimensionale Organoide mit gewebeähnlichen Strukturen zu züchten. Seit 2022 erkennt die Food and Drug Administration Organoide in der präklinischen Forschung als Alternative zu Tierversuchen an.
Inzwischen konnte gezeigt werden, dass sich Organoide als Modelle für die Entwicklung der fetalen Lunge eignen, schreibt ein Team um Lorenzo Zanetto vom Universitätsklinikum in Padua. Mit den geschaffenen Gewebestückchen lassen sich sowohl Zell-Zell- als auch Wirt-Pathogen-Interaktionen untersuchen. Sie erlauben molekularbiologische Analysen zu genetisch bedingten Erkrankungen. Zudem können pulmonale Organoide genutzt werden, um Wirkstoffkandidaten oder Kombinationstherapien zu testen.
Funktionierende kleine Modelle sind skalierbar
Verschiedene Anwendungen zur Personalisierung von Therapien sind denkbar, wenn als Ausgangsmaterial Zellen von Patientinnen und Patienten verwendet werden. Schließlich könnten Organoide künftig in der regenerativen Medizin als Quelle für transplantierbares Material dienen. Bei allem hat ein Gewebemodell einen großen Vorteil: Ist es erst einmal etabliert, lässt es sich gut skalieren.
Organoide kamen in der präklinischen Forschung zu Atemwegsproblemen von Neu- bzw. Frühgeborenen bereits bei einer Reihe von unterschiedlichen Erkrankungen zum Einsatz: Atemnotsyndrom, alveoläre kapilläre Dysplasie, genetisch bedingter Surfactant-Protein-B-Mangel, angeborene Zwerchfellhernie sowie bronchopulmonale Dysplasie. Dabei ging es nicht nur um neue Wirkstoffe, sondern auch um Gentherapien und Interventionen. Bei den Lungenerkrankungen des Kindesalters standen zystische Fibrose, RSV-Bronchiolitis, Asthma und Lymphangioleiomyomatose im Fokus der Forschung.
Einen wichtigen Schritt nach vorne habe man mit der Herstellung von Organoiden aus Zellen der Amnion- und Trachealflüssigkeit bzw. anhand von Material aus der bronchoalveolären Lavage gemacht, meint das Autorenteam. Diese Methoden können Alternativen zu bisherigen Verfahren bieten, die Stammzellen aus adultem Gewebe, induzierte pluripotente Stammzellen oder embryonale Stammzellen als Ausgangsmaterial für Lungenorganoide verwenden. Fortschritte gibt es auch bei anderen, den Organoiden verwandten Modellen, darunter die Lunge-auf-Chip-Systeme.
Aktuell bestehen erhebliche methodische Unterschiede zwischen den Laboren, was die Vergleichbarkeit von Studienergebnissen erschwert, betont das Autorenteam. Auch wenn es zunehmend gelingt, Organoide von unterschiedlicher Komplexität und mithilfe verschiedener Lungenzelltypen zu züchten, werden künftig Modelle benötigt, die auch vaskuläre, neuronale und immunologische Aspekte besser integrieren.
Quelle: Zanetto L et al. Eur Respir Rev 2025; 34: 240255; doi: 10.1183/16000617.0255-2024