
Autoimmunerkrankungen im Vergleich MOGAD oder MS? Schübe bleiben für die Differenzialdiagnostik zentral
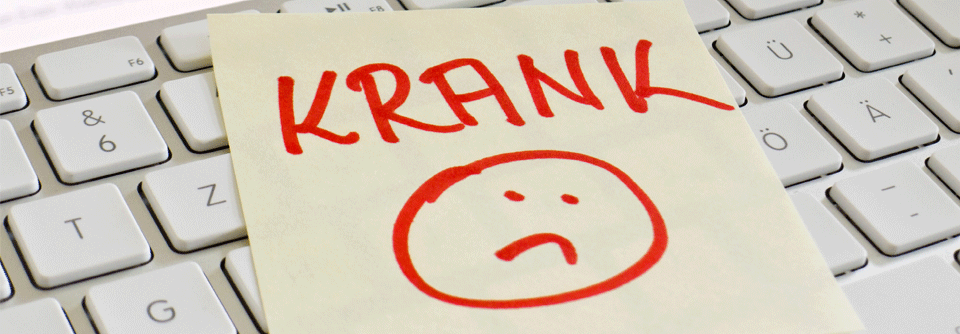 Bei der Multiplen Sklerose gilt eine Krankheitsprogression, die sich unabhängig von klinischen Schüben entwickelt, mittlerweile als wichtiger Verlaufsparameter. Aber existiert dieses Phänomen auch bei MOGAD?
© Gina Sanders - stock.adobe.com
Bei der Multiplen Sklerose gilt eine Krankheitsprogression, die sich unabhängig von klinischen Schüben entwickelt, mittlerweile als wichtiger Verlaufsparameter. Aber existiert dieses Phänomen auch bei MOGAD?
© Gina Sanders - stock.adobe.com
Bei der Multiplen Sklerose gilt eine Krankheitsprogression, die sich unabhängig von klinischen Schüben entwickelt, mittlerweile als wichtiger Verlaufsparameter. Aber existiert dieses Phänomen auch bei MOGAD?
Als ein Eckpfeiler in der Pathophysiologie der Multiplen Sklerose (MS) gilt mittlerweile das Fortschreiten der Erkrankung unabhängig von Schubereignissen (progression independent of relapse activity, PIRA). Anders verhält es sich bei der klinisch verwandten MOGAD*: Bei dieser Krankheit geht man nach wie vor davon aus, dass Neurodegeneration und klinische Beeinträchtigung stets in Abhängigkeit von Schüben fortschreiten. Für diese Annahme lagen bislang jedoch kaum Daten vor.
Ein Team um Dr. Valentina Camera von der University of Oxford überprüfte dies in einer prospektiven Studie, an der 20 Patientinnen und Patienten mit MOGAD und 32 Personen mit schubförmig remittierender MS (RRMS) teilnahmen. Die beiden Gruppen waren gematcht nach Alter, Geschlecht und Beeinträchtigungen zu Studienbeginn. Keiner der Teilnehmenden hatte in den vorangegangenen sechs Monaten einen Krankheitsschub erlitten. Die Kontrollgruppe bildeten 21 gesunde Personen.
Als Kriterien für die Progression galten Verschlechterungen im Behinderungsstatus auf der Expanded Disability Status Scale (EDSS) sowie zunehmende kognitive Symptome, gemessen mit der Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests (BRBNT). Der mediane Follow-up-Zeitraum betrug rund 17 Monate.
Auch mikrostrukturelle Hirnschäden wurden erfasst
Parallel zu den Tests fanden bildgebende Untersuchungen zur Beurteilung der Neurodegeneration statt. Dabei kam die diffusionsgewichtete Magnetresonanztomografie zum Einsatz. Per NODDI-Verfahren (Neurite Orientation Dispersion and Density Imaging) bewerteten die Forschenden die mikrostrukturelle Schädigung der weißen und grauen Substanz. Auch das Hirnvolumen, die kortikale Dicke sowie das Verhältnis zwischen den Volumina der grauen und weißen Substanz wurden wiederholt bestimmt.
Eine „klinische PIRA“ lag vor, wenn im EDSS frühestens sechs Monate nach Studienbeginn eine Verschlechterung auftrat, die auf eine progrediente Funktionseinschränkung hinwies, ohne dass Schübe berichtet worden waren. Die Schwelle war dabei abhängig vom Ausgangswert – wer zu Studienbeginn einen EDSS von 0 hatte, musste sich um mindestens 1,5 Punkte verschlechtern; bei einem Ausgangs-EDSS von 1–5 galt eine Zunahme um ≥ 1 Punkt als relevant und ab einem Ausgangswert von 5,5 genügte bereits eine Zunahme um 0,5 Punkte. Zwei der 32 Patientinnen und Patienten (6,3 %) mit RRMS erfüllten im Studienverlauf dieses Kriterium, jedoch keiner der Teilnehmenden mit MOGAD.
„Kognitive PIRA“ trat ebenfalls nur bei MS-Erkrankten auf
Ähnlich sah es bei der „kognitiven PIRA“ aus. Diese galt als erfüllt, wenn unabhängig von Schüben eine Verschlechterung im BRBNT-Score verzeichnet wurde. Das zeigte sich bei zwei von 30 diesbezüglich untersuchten Personen (6,7 %) in der MS-Gruppe und bei keinem Teilnehmenden mit MOGAD.
In der Bildgebung zeigten sich bei MOGAD keine signifikanten Änderungen, die auf eine fortschreitende Neurodegeneration hindeuten. Im Vergleich dazu wies die RRMS-Gruppe während der Beobachtungszeit eine deutlich stärkere Atrophie des Thalamus, des Hippocampus und der grauen Substanz auf. Nur bei den MS-Betroffenen entwickelten sich außerdem neue Läsionen > 40 mm3 in der weißen Substanz.
Sollten sich diese Ergebnisse in größeren, noch differenzierter durchgeführten Studien bestätigen, müsse man davon ausgehen, dass MOGAD andere pathophysiologische Mechanismen zugrunde liegen als MS, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Dr. Camera. In der Praxis solle bei MOGAD der Schwerpunkt darauf liegen, Schübe frühzeitig zu erkennen und mit geeigneten Therapien möglichst zu stoppen. Bei MS hingegen bleibe es entscheidend, neben der Schubkontrolle auch die davon unabhängige Krankheitsprogression im Blick zu behalten.
*Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein (MOG)-Antikörper-assoziierte Erkrankung
Quelle: Camera V et al. Neurol Open Access 2025; doi: 10.1212/WN9.0000000000000013



