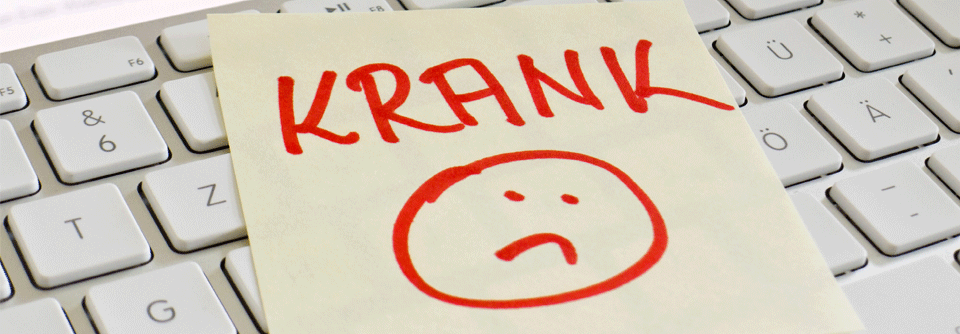Tabu oder To-Do? Sexualität bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen ansprechen
 Laut WHO ist die Sexualität ein zentraler Aspekt des Menschseins, sie spielt über die gesamte Lebensspanne hinweg eine wichtige Rolle und ist nicht auf bestimmte Altersgruppen oder Lebenssituationen beschränkt.
© drubig-photo - stock.adobe.com
Laut WHO ist die Sexualität ein zentraler Aspekt des Menschseins, sie spielt über die gesamte Lebensspanne hinweg eine wichtige Rolle und ist nicht auf bestimmte Altersgruppen oder Lebenssituationen beschränkt.
© drubig-photo - stock.adobe.com
Auch im Jahr 2025 ist ein offenes Gespräch über Sexualität in der ärztlichen Praxis keine Selbstverständlichkeit. Das Thema scheint zwar in den Medien omnipräsent zu sein, auf individueller Ebene bleibt es jedoch häufig vernachlässigt. Dies ist insbesondere im Kontext von chronischen Erkrankungen der Fall „und ich hoffe, dass ich Sie im Laufe des Vortrags überzeugen kann, dass das ein ganz klares To-Do für uns alle sein sollte“, sagte Dr. Isabell Haase vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Laut WHO ist die Sexualität ein zentraler Aspekt des Menschseins, sie spielt über die gesamte Lebensspanne hinweg eine wichtige Rolle und ist nicht auf bestimmte Altersgruppen oder Lebenssituationen beschränkt. Weiterhin definiert die WHO eine sexuelle Gesundheit, welche untrennbar mit der Gesamtgesundheit verbunden ist. Autoimmunerkrankungen beeinflussen diese sexuelle Gesundheit und verringern damit die Lebensqualität der Betroffenen noch zusätzlich.
Durch die in der Praxis oft fehlende Thematisierung bleibt das Problem der eingeschränkten sexuellen Funktion oft unter dem Radar. Die Prävalenz der sexuellen Dysfunktion liegt bei Patientinnen und Patienten mit rheumatischen Erkrankungen weit über der in der Allgemeinbevölkerung. Immerhin berichten 50 % bis 70 % der Erkrankten über Einschränkungen, vor allem bei
- der Psoriasisarthritis,
- der rheumatoiden Arthritis,
- dem Sjögren-Syndrom
- und der systemischen Sklerose.
Aber auch Menschen, die an systemischem Lupus erythematodes, Myositiden oder schweren Gelenkmanifestationen leiden, berichten von sexuellen Einbußen.
Einfache Fragen, große Wirkung
Mit dem vierstufigen PLISSIT-Modell kann man das Thema Sexualität im Patientengespräch sensibel, aber gezielt ansteuern:
- Erlaubnis: Die Erlaubnis geben, über sexuelle Themen zu sprechen. „Viele Patienten mit ihrer Erkrankung haben in dem Bereich auch mal Probleme. Ist das bei Ihnen auch ein Thema?“
- Begrenzte Informationen: Grundlegende Aufklärung über das jeweilige Thema. Erfordert etwas Fachwissen.
- Konkrete Vorschläge: Basierend auf einer umfassenden Betrachtung der vorliegenden Probleme Vorschläge unterbreiten.
- Vertiefende Behandlung: Überweisung zur vertiefenden Therapie einschließlich psychologischer Interventionen, Sexualtherapie.
Fragebögen wie der „Female Sexual Function Index“ oder „Qualisex“ können unterstützend genutzt werden, stellen aber keine Voraussetzung für ein Gespräch dar. Der wichtigste Schritt bleibt: offen sein, zuhören und entabuisieren.
Das Spektrum der Beschwerden reicht von verminderter Libido über Lubrikations- oder Erektionsstörungen bis hin zu Orgasmusschwierigkeiten und unvollständiger Befriedigung, erklärte die Referentin. Neben Schmerzen, Gelenkversteifungen oder Fatigue tragen auch psychische Faktoren wie Depression, Ängste oder ein verändertes Körperbild bzw. eine veränderte Selbstwahrnehmung zu der reduzierten sexuellen Gesundheit bei. „Die Betroffenen fühlen sich einfach nicht mehr attraktiv, nicht mehr sexy“, fügte Dr. Haase hinzu. Sie berichten häufig auch von Frustration, Schuldgefühlen und letztlich der Angst davor, ihre Partnerin bzw. ihren Partner zu verlieren.
Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Punkt ist die Medikation. Einige Patientinnen und Patienten vermuten dort die Ursache ihrer sexuellen Probleme, doch klassische Antirheumatika sind selten verantwortlich. Anders sieht es jedoch bei Ko-Medikationen wie Antidepressiva, Kortikosteroiden oder Muskelrelaxantien aus. Sie können durchaus Einfluss auf die Libido und die sexuelle Reaktion nehmen.
Eine sehr wirksame Intervention ist es, die Sexualität proaktiv, aber sensibel anzusprechen (s. Kasten). Denn das Gespräch alleine kann schon eine entlastende Wirkung entfalten. „Es gibt wenige falsche Zeitpunkte für ein Gespräch. Wenn sich die Betroffenen in einer gut eingestellten Krankheitsphase befinden, sollten Sie das auf jeden Fall thematisieren“, bekräftigte die Referentin.
Im Dialog lassen sich auch praktische Tipps vermitteln. Diese reichen von Wärmeanwendungen zur Gelenkentlastung, Gleitmitteln, schmerzarmen Stellungen, Schmerzmitteln (bis zu 30 Minuten vor dem Akt einzunehmen) und Paar-Kommunikation bis hin zur Erkenntnis, dass nicht nur Penetration „richtiger Sex“ ist.
Typisch Mann
Prof. Dr. Uta Kiltz vom Rheumazentrum Ruhrgebiet in Herne beleuchtete die Versorgungssituation männlicher Patienten mit Autoimmunerkrankungen. Männer sind zwar seltener von Autoimmunerkrankungen betroffen als Frauen, haben aber häufiger schwere Verläufe und stärkere Organmanifestationen, z. B. bei der axialen Spondyloarthritis, der Psoriasisarthritis, der systemischen Sklerose und dem systemischen Lupus erythematodes.
„Männer zeigen häufiger entzündliche Veränderungen in der MRT, stärkeren strukturellen Schaden an der Wirbelsäule oder kardiopulmonale Komplikationen“, so Prof. Kiltz. Diese Unterschiede seien auf hormonelle, genetische und immunologische Faktoren zurückzuführen.
Wenn es um Beratung zur Familienplanung ginge, so könne man die meisten Antirheumatika bedenkenlos weiter einnehmen. Die Ausnahme stellt Cyclophosphamid dar, welches die Keimzellen schädigt, genotoxisch und mutagen wirkt und bei Männern zu Fertilitätsproblemen führt.
Auf die medizinischen Herausforderungen einer Schwangerschaft bei Patientinnen mit Autoimmunerkrankungen ging Dr. Ann-Christin Pecher vom Universitätsklinikum Tübingen, ein. Ein zentrales Element der Beratung ist die Krankheitsaktivität. Insbesondere der systemische Lupus erythematodes, die systemische Sklerose und das Antiphospholipidsyndrom stehen im Fokus.„Patientinnen sollten mindestens sechs Monate in Remission oder ihre Krankheitsaktivität niedrig sein (low disease activity), bevor eine Schwangerschaft geplant wird“, betonte die Referentin. Dies reduziert das Risiko für maternale Komplikationen wie Präeklampsie, Krankheitsschübe oder renale Exazerbationen deutlich.
Bei werdenden Müttern, die an Lupus erkrankt und SSA-positiv sind, ist das Risiko für kardiale Komplikationen beim ungeborenen Kind hoch. Die Gabe von Hydroxychloroquin senkt das Risiko eines kongenitalen AV-Blocks verlässlich um ca. 50 %, empfohlen wird zudem die regelmäßige Überwachung des Kindes mittels fetaler Echokardiografie.
Nach aktualisierter EULAR-Leitlinie besteht heute eine größere therapeutische Sicherheit bei vielen Autoimmunerkrankungen. Präparate wie Azathioprin, Sulfasalazin und Hydroxychloroquin können während der gesamten Schwangerschaft und Stillzeit eingenommen werden. Auch TNF-Blocker dürfen nach EULAR-Empfehlung in der Schwangerschaft fortgeführt werden. Mycophenolat, Methotrexat und Cyclophosphamid bleiben kontraindiziert und sind bei Kinderwunsch vorsorglich zu pausieren. Zu JAK-Inhibitoren gibt es noch zu wenige Daten, deshalb wird auch bei ihnen das Absetzen bei Kinderwunsch empfohlen.