
Plättchenreiches Plasma bei Kniearthrose in der Diskussion Plättchenreiches Plasma bei Arthrose: Therapie oder teurer Bluff?
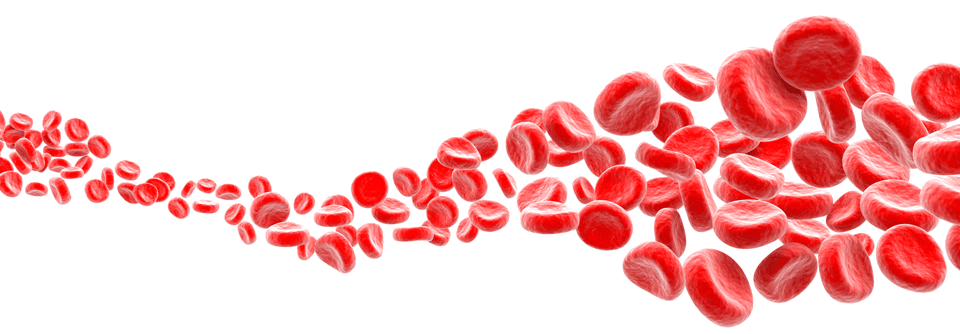 Beim plättchenreichen Plasma zur Arthrosebehandlung scheiden sich die Geister.
© Alex Mit - stock.adobe.com
Beim plättchenreichen Plasma zur Arthrosebehandlung scheiden sich die Geister.
© Alex Mit - stock.adobe.com
Beim plättchenreichen Plasma zur Arthrosebehandlung scheiden sich die Geister. Für die einen ist das Verfahren Hokuspokus, für die anderen eine effektive Therapie. In Barcelona gab es dazu einen handfesten Schlagabtausch.
Nützt plättchenreiches Plasma (PRP) bei Arthrose den Betroffenen oder sind die Injektionen nur gut für Doktors Portemonnaie? Um diese provokative Frage zu beantworten, hatte das EULAR-Komitee zwei hochkarätige Experten geladen: Prof. Dr. Elizaveta Kon von der Humanitas University in Mailand als Befürworterin des Verfahrens und Prof. Dr. David Hunter, University of Sydney, als PRP-Gegner. Vor dem Wortgefecht stimmte zunächst das Publikum ab. Mit 43,3 % votierte eine Minderheit für die Anwendung von PRP-Injektionen bei Arthrose, mit 56,7 % lehnte mehr als die Hälfte der Anwesenden die Methode eher ab.
Zunächst hielt Prof. Kon ihr Plädoyer. In einem dramatischen, an die Star-Wars-Filme angelehnten Lauftext verglich sie sich mit einem Jedi-Ritter, der im unendlichen Universum gegen die veraltete, vom JAMA* und verschiedenen Fachgesellschaften propagierte Lehrmeinung („PRP-Injektionen gegen Gonarthrose werden nicht empfohlen“) ankämpfen muss. Für sie ist die Sache klar: PRP-Injektionen sind effektiv. Anderslautende Studienergebnisse kranken ihrer Meinung nach an methodischen Fehlern und an zu niedrig dosierten Konzentraten. Der wichtigste Punkt: Die intraartikulären Injektionen wirken vor allem langfristig bei Arthrose – wohingegen die offiziell empfohlenen Glukokortikoidspritzen nur kurze Effekte zeitigten und langfristig nicht besser seien als Placebo.
Krankheitsmodifizierende Effekte in etlichen Studien
Zudem solle die Therapie ja nicht nur Schmerzen lindern. In Tierversuchen hätten die Injektionen mit plättchenreichem Plasma in 68 % von 44 Veröffentlichungen krankheitsmodifizierende Effekte gezeigt, sowohl auf die Synovia als auch auf den Knorpel, führte die Referentin aus. In ähnlicher Größenordnung wiesen das in einer Auswertung von 32 Studien auch Glukokortikoide auf. Allerdings zeigten sich darunter auch zu 16 % schädliche Effekte auf die Gelenke.
Ein weiteres Argument für Injektionen mit PRP: die wachsende Anzahl klinischer Untersuchungen, unter denen neben Fallserien auch etliche randomisierte, kontrollierte Studien seien. Für die 2021 im JAMA publizierten negativen Ergebnisse1 hatte sie eine Erklärung parat: In dieser Arbeit seien zu niedrige PRP-Konzentrationen eingesetzt worden.
PRP sei allerdings kein Heilmittel für alle Arthrosepatientinnen und -patienten, schränkte Prof. Kon ein. Sie sieht den Platz des Verfahrens insbesondere in der zweiten Linie bei tibio- und patellofemoralen Arthrosen bis zu Grad III nach Kellgren-Lawrence (KL). Absehen von einer Behandlung mit PRP sollte man bei patellofemoralen Arthrosen KL IV, vor allem bei starkem Gelenkerguss. Ebenfalls nicht zu empfehlen sei die Methode bei einem Knochenödem > Grad 3 nach WORMS**.
Dass plättchenreiches Plasma bei Arthrose effektiv ist, unterstreicht ihrer Meinung nach auch das Statement der American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), demzufolge PRP-Injektionen bei Kniearthrose einen Nutzen haben. Die European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) geht noch weiter: Deren Experten empfehlen die Injektionen schon bei milder bis moderater Gonarthrose.
Klar gegen PRP-Injektionen argumentierte Prof. Hunter, Mitautor der im JAMA veröffentlichten Meilensteinstudie zu PRP-Behandlungen. Darin fanden sich bei knapp 200 Männern und Frauen mit Gonarthrose hinsichtlich Schmerzlinderung oder Verbesserung des Knorpelvolumens keine signifikanten Vorteile von PRP gegenüber Injektionen mit Kochsalz.
Nach der Veröffentlichung habe das Autorenteam einen wahren Shitstorm hinnehmen müssen, berichtete Prof. Hunter. Er wertete das als ein Zeichen dafür, dass es beim plättchenreichen Plasma vor allem um eines geht: ums liebe Geld. Immerhin wird das globale Geschäft mit PRP-Produkten für das Jahr 2025 auf eine knappe Milliarde Dollar geschätzt. Bis 2034 soll sich das Marktvolumen mehr als verdreifachen.
Prof. Hunter zerpflückte auch die vielen positiven Studien, die Prof. Kon angeführt hatte. So sei vielfach nicht klar, was eigentlich in die Gelenke gespritzt werde. Die Injektionen unterschieden sich im Volumen, in der Anzahl der Plättchen, der Leukozyten und der Wachstumsfaktoren. Auch die Herstellung der Präparate und die Patientencharakteristika variierten stark. Zudem herrscht offenbar ein erheblicher Publikationsbias. Denn von 102 Einträgen in clinicaltrials.gov wurden zwar 52 Arbeiten beendet, aber nur von fünfen sind bislang die Ergebnisse publiziert. 16 Studien befinden sich noch in der Rekrutierungsphase, bei 24 ist der Status unbekannt.
Die Kritik, in seiner im JAMA publizierten Arbeit seien zu niedrige Plättchenkonzentrationen verabreicht worden, wies er zurück. Denn offenbar seien sich die Befürworter der Methode in dieser Sache selbst uneins. Er selbst habe gerade vor einigen Tagen eine Studie auf dem Schreibtisch gehabt, in der postuliert wurde, dass insbesondere niedrig konzentriertes Plasma wirksam sei.
In puncto Effektivität müsse man bedenken, dass bei Arthrose Verbesserungen nicht nur durch Medikamente, sondern auch durch unspezifische Einflüsse hervorgerufen werden. In der Folge könnten vermeintliche Effekte schnell überbewertet werden, meinte Prof. Hunter.
Sprechen Sicherheitssignale gegen das Plasma?
Doch das Plasma wirke nicht nur einfach nicht, es gebe auch Sicherheitsbedenken. Neben Schmerzen und Schwellungen am behandelten Knie kann es u. a. zu Synkopen, Schwindel, Tachykardie und Gastritis kommen, führte Prof. Hunter aus. Daneben stört ihn der pekuniäre Aspekt: Eine Behandlungsrunde kostet etwa 1.000 US-Dollar, und es sind mehrere davon nötig. Von den Kassen werden die Kosten aber nicht übernommen.
Schließlich führte Prof. Hunter noch die Leitlinien an. Gegen PRP-Injektionen bei Cox- oder Gonarthrose sprechen sich u. a. sowohl die American College of Radiology (ACR) als auch die Osteoarthritis Research Society International (OARSI) aus.
Dass die AAOS – wie Prof. Kon ausgeführt hatte – der PRP-Injektion einen möglichen positiven Effekt zuschreibt, sei korrekt. Allerdings sei die Empfehlung schwach, und die Fachgesellschaft fordere weitere Studien. Das positive Voting der ESSKA für das plättchenreiche Plasma sieht er im Kontakt der Organisation mit der PRP-Industrie begründet, was im Übrigen in den Interessenskonflikten der Gruppe klar zum Ausdruck komme.
Prof. Hunter rät dazu, nicht Fake News und Fehlinformationen zu folgen, sondern auf wissenschaftliche Evidenz zu setzen. Und die spreche gegen das PRP. Alles in allem sei der Schaden mit Blick auf Kosten, Risiken und fragwürdige Effekte deutlich größer als der bisher nur nach Placeboeffekt riechende Nutzen der Prozedur.
Das Publikum sah das nach dem Schlagabtausch der beiden Kontrahenden anders: Jetzt glaubten gut 51 % aus dem Auditorium an den Nutzen des plättchenreichen Plasmas.
*Journal of the American Medical Association
**Whole-Organ Magnetic Resonance Imaging Score
1. Bennell KL et al. JAMA 2021; 326: 2021-2030; doi: 10.1001/jama.2021.19415



