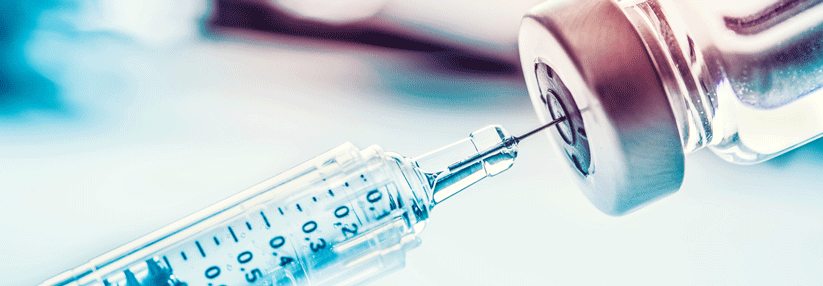
Psychische Probleme nach Behandlung auf der Intensivstation?
 Bis zu 80 % der Patienten leiden unter physischen und psychischen Folgen einer Therapie auf der Intensivstation. (Agenturfoto)
© iStock/vm
Bis zu 80 % der Patienten leiden unter physischen und psychischen Folgen einer Therapie auf der Intensivstation. (Agenturfoto)
© iStock/vm
Viele Intensivpatienten leiden nach ihrer Entlassung an physischen, psychischen und kognitiven Folgen der Behandlung. So kann es zu Angstsymptomen, Depressionen oder einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen. Mittlerweile hat sich dafür der Begriff „Post-Intensive Care Syndrome“, kurz PICS, etabliert. Nun entwickelt nicht jeder auf einer Intensivstation behandelte Patient ein PICS. In einigen Studien wurden jedoch Zahlen von bis zu 80 % ermittelt, schreiben Dr. Gretchen A. Colbenson vom Department of Medicine der Mayo Clinic in Rochester und ihre Kollegen. Vor allem nach langen und invasiven Behandlungen wie einer maschinellen Beatmung tritt das Syndrom gehäuft auf.
Die Sedierung scheint eine wesentliche Rolle in der Entstehung eines PICS zu spielen (Benzos!). Immer mehr Intensivstationen gehen daher dazu über, spezielle evidenzbasierte Programme wie das „ABCDEF-Bundle“ in ihre Behandlung zu integrieren. So sollen die Maßnahmen auf der Station so kurz wie möglich gehalten und die Kranken frühzeitig mobilisiert werden. Der Erfolg solcher Programme spricht für sich: Durch sie können Patienten bis zu dreimal häufiger ihre früheren Funktionen wiedererlangen.
Der Vater ist nicht mehr der, der er vorher war
Dennoch, das PICS lässt sich nicht komplett verhindern. Man sollte daher die Familie, die meist den Hauptteil der häuslichen Betreuung übernimmt, darauf vorbereiten. So müssen die Angehörigen damit rechnen, dass der Patient zunächst vielleicht verändert erscheint, ihm aber eine ganze Reihe von Maßnahmen dabei helfen können, den Alltag selbstständig zu bewältigen (s. Kasten). Viele dieser Verfahren lassen sich auch von zu Hause aus umsetzen, wobei man auch Techniken der Telemedizin oder Telefonsupport nutzen kann.
Zurück in die Selbstständigkeit
Betroffene sind häufig uneinsichtig
All dies unterstützt nicht nur die Patienten, sondern auch die Familien darin, mit der oft unerwarteten Belastung umzugehen – schließlich hatte man angenommen, der Verwandte sei wieder gesund, nun da er aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Am schwierigsten wird es sein, den Betroffenen selbst von diesen Maßnahmen zu überzeugen, schreiben die Autoren. Oft genug ist er sich vor allem seiner psychischen Probleme nicht bewusst oder ihm ist unklar, wie diese mit dem Aufenthalt auf der Intensivstation zusammenhängen. Auf alle Fälle sollte einige Monate später eine Nachuntersuchung erfolgen, die nicht nur die harten medizinischen Fakten berücksichtigt, raten die Kollegen. Die kognitive und psychische Situation des Patienten sei genauso relevant.Quelle: Colbenson GA et al. Breathe 2019; 15: 98-101; DOI: 10.1183/20734735.0013-2019








